Lateinamerika und Corona
[DE] Unter dieser Rubrik sammeln wir aus dem Anlass der aktuellen Corona-Pandemie Beiträge von Studierenden, Lehrenden und KooperationspartnerInnen der Lateinamerika-Studien Hamburg, die sich aus unterschiedlichen Perspektiven mit dem Zusammenhang von Corona und Lateinamerika auseinandersetzen. Dabei werden diverse Erfahrungen, Einblicke und Reflektionen wiedergeben, die sich auf unterschiedliche Dimensionen der Coronakrise in Lateinamerika beziehen, vom Alltag in Lateinamerika bis hin zu globalen Zusammenhängen oder der Verflechtung mit Deutschland.
Für die folgenden Texte sind die jweiligen Autor:innen verantwortlich.
[ESP] En el marco de la actual pandemia por coronavirus, estamos recopilando los aportes de estudiantes, conferencistas y socios cooperadores de los Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Hamburgo, que abordan la conexión entre el coronavirus y Latinoamérica desde diferentes perspectivas. En este sentido, se presentarán diversas experiencias, percepciones y reflexiones relacionadas con diferentes dimensiones de la crisis del coronavirus en América Latina, desde la vida cotidiana hasta contextos globales o su relación con Alemania.
Los respectivos autores son responsables por los textos.
Alejandra Moreno Barrera/ Lorena Cardenas Niño (15.01.2021): Die Pandemie, eine Bedrohung für den Frieden in Kolumbien | La pandemia, una amenaza para la paz en Colombia.
Dieser Text ist in zwei Sprachen verfügbar:
Este texto está disponible en dos idiomas:
Español
La pandemia, una amenaza para la paz en Colombia.
Alejandra Moreno Barrera
Lorena Cardenas Niño
15/01/2021
 |
Alejandra Moreno Barrera es polítologa internacionalista con enfasís en Comunicación y Marketing político de la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá Colombia. Actualmente es estudiante de la Maestría de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Hamburg Alemania.
|
Cuando llegó el coronavirus a Colombia a finales del mes de febrero, Alejandra y yo nos encontrábamos visitando a nuestras familias, apenas hace algunos días habíamos arribado al país. Uno de los objetivos del viaje de Alejandra era reunir los datos de su investigación de tesis de maestría en estudios latinoamericanos. Su campo de trabajo se centra en la temática del narcotráfico en Colombia y en México.
Con el pasar de los días durante el mes de marzo todo se volvió un poco impredecible e irreal. A partir del 11 de marzo el presidente Iván Duque emitió una locución presidencial (estas locuciones se hicieron constantes y persisten hasta la fecha) en la que informaba a la ciudadanía que el coronavirus se había convertido en una pandemia mundial y que por tal motivo el país entraría en un aislamiento preventivo, inicialmente, de catorce días. Se cancelaron todos los eventos que congregarán más de 50 personas en un mismo sitio, se dio orden de cierre de colegios, universidades, restaurantes, bares, bibliotecas, museos, centros de recreación, centros deportivos y aeropuertos; lo que significaba que ningún vuelo de carácter nacional o internacional podría salir o aterrizar en Colombia. Este confinamiento preventivo se extendió paulatinamente hasta convertirse en una cuarentena de 212 días.
Esta serie de medidas generó una cadena de consecuencias de carácter económico, cultural, psicológico y social para los colombianos y los dos millones de venezolanos que residen actualmente en Colombia.
Esta situación de temor e incertidumbre nos trajo a la memoria el período del conflicto armado que atemorizaba con una avalancha de violencia a gran parte de la población rural. Estos hechos acompañaron nuestra infancia y marcaron nuestros recuerdos y fueron evocados por la incertidumbre vivida al inicio de la pandemia, en donde fuimos arrebatados de nuestras actividades cotidianas para ser confinados en nuestras propias viviendas a la espera de un levantamiento de las medidas de asilamiento y con el temor de vivir con un mal invisible al acecho.
Los temores fueron fortaleciendo a la población haciendo cada vez más claro frente a los gobiernos de turno su exigencia de un acuerdo de paz con los actores del conflicto. La esperanza de una nación libre de conflictos armados se materializó con la firma de los acuerdos de paz en el 2016. El cumplimiento de estos acuerdos se vio gravemente afectado por la pandemia, en la medida en que el gobierno transformo sus prioridades y se concentró en la creación de medidas para mitigar la expansión del covid.
La pandemia es un gran reto para la paz y por ende para la seguridad en Colombia. El país ha logrado una recuperación notoria en aspectos de seguridad social como por ejemplo el índice de homicidios, el de secuestros, acciones subversivas, ataques terroristas, desplazamientos forzados, etc. Sin embargo, durante la pandemia se hicieron evidentes sucesos de violencia dirigida hacia determinados objetivos en la comunidad.
Estas masacres, llamadas por el gobierno Duque “homicidios colectivos”, se ejecutaron durante la pandemia en un ámbito de impunidad, deslegitimando los reclamos de la sociedad, escudándose así el gobierno en las medidas de confinamiento a causa del covid, para no enfrentar el problema de seguridad y a través de esa nueva nominación (homicidio colectivo) disminuir el significado de estos hechos. Víctimas de estas masacres son los líderes sociales; hasta el momento se eleva la cifra a 231 personas asesinadas y 148 firmantes de la paz que igualmente han muerto a manos de sicarios durante el aislamiento. [1]
A esto se suma la imposición arbitraria de parte de los grupos armados de sus propias medidas de aislamiento a razón del covid en las que se pueden enumerar, el establecimiento de precios de los víveres, de los horarios de transporte, horarios de salida y llegada de las personas a sus viviendas, horarios del comercio, llegando al punto de someter a funcionarios del estado a dichas reglas y cuyo incumplimiento les costaría la vida. Hechos como la masacre de Samaniego Nariño, en donde 8 estudiantes fueron asesinados, al parecer por integrantes del ELN (Ejército de Liberación Nacional) por no respetar la cuarentena y de la misma forma la masacre de 3 escolares en Llano Verde en Cali, dejan en evidencia la falta de control estatal sobre monopolio armamentista y sobre la soberanía frente al cumplimiento de las normas preventivas de asilamiento arazón del covid [2]. En ese orden de ideas se muestra a continuación la gráfica de masacres en lo recorrido del periodo de los años 2008 hasta el 2020.
En este grafico se muestra que el número de masacres disminuyeron en este lapso, sin embargo, en lo recorrido del 2020 se puede notar un aumento del 12% de estas acciones, así mismo con un número de79 Victimas más que en el año 2019.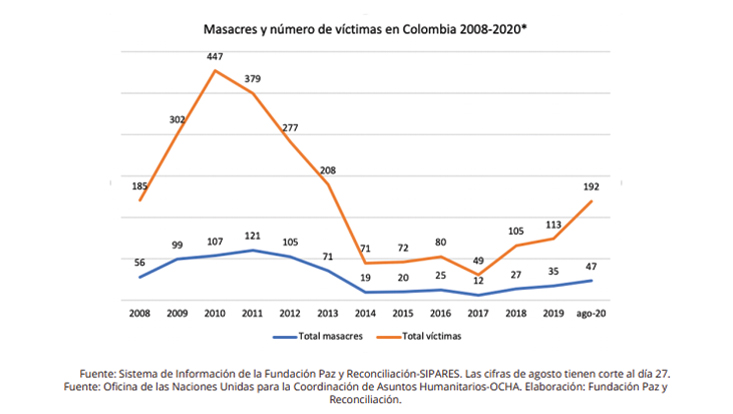
Está grafica muestra un ejemplo de transición de las masacres en Colombia en la última década antes y después de los acuerdos de paz. Sin embargo, es importante resaltar que estas cifras no son sólo números, sino seres humanos con familias, asunto que ni el gobierno nacional ni los grupos armados toman en cuenta y mucho menos en tiempos de pandemia.
Luego de la suscripción de los acuerdos de paz el 24 de noviembre de 2016, muchos perjudicados pensamos que las cosas iban a cambiar y que la violencia cesaría, pero lastimosamente ni el Coronavirus la ha podido detener.
En Colombia al inicio de la cuarentena estricta en marzo 25 de 2020 se reportaron 235 infecciones por Covid en el país y 4 muertes. A la fecha de hoy, 12 de diciembre de 2020 se confirman 1.408.909 contagios y 38.669 muertes por covid 3. Con estas cifras relacionadas con dos temas de vital importancia y de actualidad nuestro país (covid 19 y la paz), queremos hacer evidente que Colombia es asediada en estos momentos, no sólo por el coronavirus, sino también el virus de la violencia y la impunidad de parte del estado.
Este panorama de acontecimientos ocurridos durante el 2020 nos deja en el plano personal pocas satisfacciones. Una de ellas fue el poder conseguir los tiquetes de regreso en un vuelo humanitario a Alemania en el mismo mes de marzo.
Abandonamos Colombia en un ambiente de desasosiego, entre medidas estrictas de distanciamiento,controles de salud y por primera vez, en un uso estricto de tapabocas y de desinfectantes por parte de las personas presentes en el aeropuerto. Al regresar a Alemania notamos con sorpresa que, en el aeropuerto de Berlín, las autoridades policiales no se habían apropiado aún de las medidas preventivas y nos asombró la falta de uso de los implementos de bioseguridad. En Colombia, a pesar de la inestable situación en el tema de orden público, se ha tratado de cumplir con las regulaciones impuestas a razón del coronavirus.
La pandemia ha sido sin duda una de las peores cosas que le paso a la humanidad en este siglo XXI, pero también nos recordó lo importantes que son el contacto humano, el contacto con la naturaleza y nuestra libertad como individuos.
[2] Rincón Juan Carlos, Torres David, Baena Maria Paulina (La Pulla) (28.08.2020), Las Masacres que no le importan a
Iván Duque. Archivo de video.
Deutsch
Die Pandemie, eine Bedrohung für den Frieden in Kolumbien
Alejandra Moreno Barrera
Lorena Cardenas Niño
15.01.2021
 |
Alejandra Moreno Barrera studierte Politikwissenschaft und Internationale Beziehungen mit den Schwerpunkten politische Kommunikation und politisches Marketing an der Universität Sergio Arboleda in Bogotá, Kolumbien. Derzeit ist sie Studentin im Masterstudiengang Lateinamerikastudien an der Universität Hamburg, Deutschland. Lorena Cardenas Niño hat einen Abschluss in internationalen Wirtschaftsbeziehungen der Stiftung Universität Autonóma de Colombia (Bogotá-Kolumbien) und ist derzeit Studentin im Masterstudiengang Lateinamerikastudien an der Universität Hamburg, Deutschland. |
Als die ersten Corona-Fälle Ende Februar in Kolumbien aufgetreten sind, waren Alejandra und ich zu Besuch bei unseren Familien in Bogotá, Kolumbien. Ein Grund Alejandras für den Aufenthalt in Kolumbien war die Recherche für die Masterarbeit in den Lateinamerikastudien. Ihr Schwerpunkt konzentriert sich auf das Thema Drogenhandel in Kolumbien und Mexiko.
Die Tage in den Monaten Februar und März vergingen und alles wurde ein wenig unvorhersehbar und unwirklich. Am 11. März hielt Präsident Ivan Duque eine präsidiale Ansprache (diese Ansprachen sind zu einer Konstanten geworden und halten bis heute an), in der er die Bürger darüber informierte, dass das Coronavirus zu einer globalen Pandemie geworden sei und dass das Land aus diesem Grund
zunächst für vierzehn Tage in eine präventive Isolation eintreten würde.
Alle Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen wurden untersagt. Schulen, Universitäten, Restaurants, Bars, Bibliotheken, Museen, Erholungszentren, Sportzentren und Flughäfen wurden angewiesen zu schließen. Daraus resultierend wurden die Inlands- und Auslandsflüge eingestellt. Diese präventive Eingrenzung wurde schrittweise auf eine 212-tägige Quarantäne ausgeweitet.
Diese Reihe von Maßnahmen sorgte für die Kolumbianer und die zwei Millionen Venezolaner, die derzeit in Kolumbien leben, im wirtschaftlichen, kulturellen, psychologischen und sozialen Bereich für tiefe und weitreichende Einschnitte ihres persönlichen Lebens.
Die Situation der Angst und Unsicherheit erinnerte uns an die Zeit des bewaffneten Konflikts, der einen großen Teil der Landbevölkerung mit einer Lawine der Gewalt in Furcht versetzte. Diese Ereignisse begleiteten unsere Kindheit und prägten unsere Erinnerungen. Sie wurden erneut durch die Ungewissheit hervorgerufen, die wir zu Beginn der Pandemie erlebten, da wir plötzlich aus unseren täglichen Aktivitäten herausgerissen wurden, Ausgangssperren einhalten mussten, während wir darauf warteten, dass die Maßnahmen der Isolation aufgehoben wurden, um mit der Angst des unsichtbaren Übels zu leben.
Im Jahr 2016 wurde der bewaffnete Konflikt in Kolumbien durch die Unterzeichnung eines Friedensabkommens mit der Farc-EP beigelegt. Dieses Abkommen und die damit einhergehenden Vereinbarungen wurde nicht zuletzt durch die stärker werdende Forderung der Bevölkerung nach Frieden realisiert. Derzeit wird die Erfüllung dieser Vereinbarungen durch die Pandemie stark beeinträchtigt, da die Regierung ihre Prioritäten änderte und sich auf die Schaffung von Maßnahmen zur Abschwächung der Ausbreitung des COVID-Virus konzentriert.
Die Pandemie ist eine große Herausforderung für den Frieden und damit für die Sicherheit in Kolumbien. Das Land hat eine bemerkenswerte Erholung in Bezug auf Aspekte der sozialen Sicherheit, wie z.B. die Abschwächung der Mordrate, abnehmende Zahlen von Entführungen, subversive Aktionen und die Reduzierung terroristischer Angriffe erreicht. Während der Pandemie gab es jedoch offensichtlich Vorfälle von Gewalt, die sich gegen bestimmte Ziele in der Gemeinschaft richteten.
Diese Massaker, die von der Regierung Duque als "kollektive Morde" bezeichnet wurden, fanden während der Pandemie in einem Umfeld der Straflosigkeit statt, sodass die Forderungen der Gesellschaft delegitimiert wurden, da die Regierung sich hinter den Einschränkungsmaßnahmen aufgrund der Pandemie versteckte, um sich dem Sicherheitsproblem nicht stellen zu müssen und durch diese neue Thematik (kollektiver Mord) die Bedeutung dieser Tatsachen zu verringern. Opfer dieser Massaker sind vorwiegend soziale Führungspersönlichkeiten. Bis jetzt beträgt die Zahl der Ermordeten aus sozialen Organisationen 231 und die Zahl der ermordeten Friedensunterzeichner 148, die während der derzeitigen staatlich verordneten Isolation umgekommen sind. [1]
Darüber hinaus verhängen die bewaffneten Gruppen willkürlich ihre eigenen Maßnahmen der Isolation auf der Grundlage von COVID, indem sie die Festlegung der Preise von Lebensmitteln, Transport, Zeiten der Abreise und Ankunft der Menschen in ihren Häusern und Öffnungszeiten des Handels vorgeben. Dies mündet in der Unterwerfung der staatlichen Beamten, da sie bei Nichteinhaltung der selbstbestimmten Regularien um ihr Leben fürchten müssen. Tatsachen wie das Massaker von Samaniego Nariño, bei dem 8 Studenten offenbar von Mitgliedern der ELN (Ejército de Liberación Nacional) ermordet wurden, weil die Studenten die Quarantäne nicht respektiert hatten, sowie das Massaker an 3 Schulkindern in Llano Verde in Cali machen die fehlende staatliche Kontrolle über das Waffenmonopol und über die Souveränität angesichts der Einhaltung der präventiven Regeln der Isolation durch COVID deutlich. [2]
In dieser Gedankenfolge ergibt sich die folgende Grafik der Massaker im Zeitraum von 2008 bis 2020. Wie der Grafik zu entnehmen ist, fiel die Anzahl der Anschläge und Opfer. Allerdings ist im Jahr 2020 ein starker Anstieg dieser Taten um 12 % zu verzeichnen. Diese Grafik zeigt den Ablauf von Massakern in Kolumbien im letzten Jahrzehnt vor und nach dem Friedensabkommen.
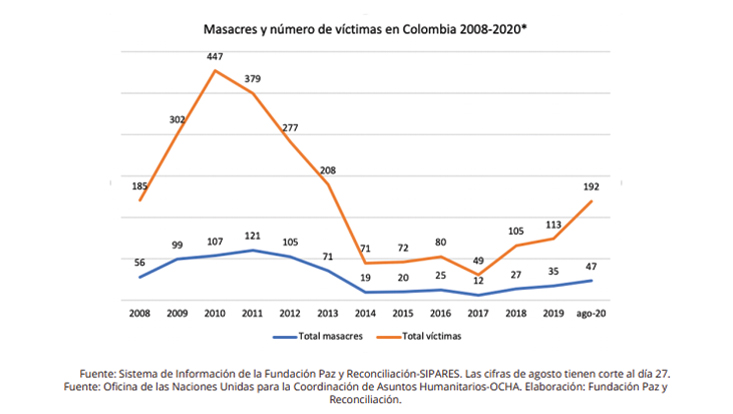
Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass es sich bei diesen Angaben nicht nur um Zahlen handelt, sondern um Menschen mit Familien, etwas, das weder die nationale Regierung noch die bewaffneten Gruppen in Zeiten einer Pandemie berücksichtigen.
Nach der Unterzeichnung des Friedensabkommens am 24. November 2016 dachten viele von uns Kolumbianern, dass sich die Dinge ändern und die Gewalt aufhören würde, aber leider ist durch COVID nun scheinbar das Gegenteil eingetreten.
In Kolumbien wurden am 25. März 2020 zu Beginn der strengen Quarantäne 235 Covid-Infektionen und 4 Todesfälle im Land gemeldet. Heute, am 12. Dezember 2020, sind es 1.408.909 Infektionen und bestätigte 38.669 Todesfälle. Mit diesen Zahlen, die sich auf zwei für unser Land lebenswichtige und aktuelle Themen beziehen (Covid 19 und Frieden) [3], wollen wir deutlich machen, dass Kolumbien derzeit nicht nur vom Coronavirus, sondern auch vom Virus der Gewalt und der Straflosigkeit vonseiten des Staates belastet wird.
Dieses Spektrum der Ereignisse im Jahr 2020 stimmt uns auf persönlicher Ebene wenig zufrieden. Ein Ereignis ergab sich dadurch, dass wir die Rückflugtickets für einen humanitären Flug nach Deutschland im selben Monat März bekommen konnten, eine Entscheidung, die beim Verbleib der eigenen Familien befremdlich schien.
Wir verließen Kolumbien in einer Atmosphäre der Unruhe inmitten strenger Distanzierungsmaßnahmen, Gesundheitskontrollen und zum ersten Mal unter strikter Verwendung von Masken und Desinfektionsmitteln durch die anwesenden Personen am kolumbianischen Flughafen. Bei unserer Rückkehr nach Deutschland waren wir überrascht, dass die Polizeibehörden sich am Berliner Flughafen die Präventivmaßnahmen noch nicht angeeignet hatten und wir waren erstaunt über den mangelnden Einsatz von Biosicherheitsgeräten. In Kolumbien wurden trotz der instabilen Lage der öffentlichen Ordnung Anstrengungen unternommen, die wegen des Coronavirus auferlegten Vorschriften einzuhalten.
Die Pandemie ist zweifellos eines der schlimmsten Dinge, die der Menschheit in diesem 21. Jahrhundert widerfahren ist, aber sie hat uns auch daran erinnert, wie wichtig der menschliche Kontakt, der Kontakt zur Natur und unsere Freiheit als Individuum ist.
[2] Rincón Juan Carlos, Torres David, Baena Maria Paulina (La Pulla) (28.08.2020), Las Masacres que no le importan a
Iván Duque. Archivo de video.
Lea Marie Nolte (22.09.2020): „Va a quedar la zorra” - Entre miedo y risas
“Va a quedar la zorra“– Entre miedo y risas
Lea Marie Nolte
22.09.2020
 |
Lea Marie Nolte ist Alumna in Sprache, Kultur, Translation der Johannes Gutenberg-Universität Mainz und aktuell Masterstudentin der Lateinamerika-Studien in Hamburg. Ab November 2019 war sie im kombinierten Studien- und Praxissemester in Santiago. Ihr Forschungsinteresse liegt in den Maskulinitätsstudien und der Postkolonialen Theorie. |
Ich kann mich noch gut an den letzten Tag erinnern, an dem ich meine Freundinnen in Santiago getroffen habe. Zum internationalen Frauenkampftag am 8. März treffen wir uns zur Mittagszeit, um im Kollektiv Juntas Mejor und Las Cabras Rollerskate gemeinsam die Avenida Providencia bis zur Plaza Dignidad entlang zu fahren. Die Straßen waren voll von Frauen*, es gab unterschiedliche Performances und wir waren bis in den Abend gemeinsam auf der Straße. Bis dahin dachte ich noch, der Amerikanische Kontinent könnte vom Corona-Virus verschont bleiben.
Eine Woche später wurde das Virus für mich Realität. In meiner WG gingen wir in freiwillige Selbstisolation - das konnten wir, da meine Mitbewohnerin und ich gerade noch Ferien hatten, und der dritte im Bunde als Musikproduzent ebenso von zuhause arbeiten konnte. „Lea, aquí va a quedar la zorra” - das sagte sie im ersten Gespräch über das Virus zu mir. Dass das Gesundheitssystem so schon immer am Rande des Kollaps steht, erfuhr ich bereits im Rahmen der Proteste, die ich seit meiner Ankunft im November miterlebte.
Wenig später berichteten auch die Nachrichten pausenlos vom Virus, die Berichterstattung im Morgenmagazin war von unheimlicher Musik unterlegt und während der damalige Gesundheitsminister Jaime Mañalich und Präsident Sebastián Piñera über das Virus berichten, fällt mir auf, wie oft nationale Bezüge hergestellt werden: „liebe Chileninnen und Chilenen”, „das Virus in unserem Land” - einmal zählte ich mit und kam im Laufe einer Stellungnahme des Gesundheitsministers auf 14 Nennungen von Chile. Wir gegen die, wir allein gegen das Virus. Es wird vom Kämpfen gesprochen. Und alle anderen Menschen nicht-chilenischer Nationalität, die in Chile leben? Die Emotionen meiner Mitbewohnenden wechseln von Wut in verzweifeltes Lachen.
Auf Instagram entdeckte ich erste Memes zum Corona-Virus, sogar ganze Accounts wie Memespalacuerentena wurden kreiert, die innerhalb kürzester Zeit mehrere Hundert Abonnent*innen erreichten. Eine beliebte chilenische Meme-Seite, Cuicxsgonnacuicc, greift die Nachricht auf, dass Haushalte in den nordwestlichen Stadtteilen aufgrund der Ausgangssperre nun ohne Hausangestellte auskommen müssen - die übrigens keine Lohnfortzahlungen erhielten - und teilt Screenshots reicher Influencer*innen, wie sie ihre ersten Erfolge beim selbständigen Kochen teilen. Während der dreiwöchigen Ausgangssperre verschwanden über Nacht die Protestslogans an der Kirche, die ich aus meinem Fenster sehen konnte. Wo vorher „Dios es gay”, „La Iglesia - Club de pedófilos” und anderes geschrieben stand, strahlte die Kirche nun in frischem pastellgelb und ein „Dios si existe!!” war hinzugekommen.
Die Militärs in den Straßen waren zurück, Plaza Dignidad überstrichen und wird nun rund um die Uhr von Polizisten bewacht. Die Avenida Providencia, die große vierspurige Straße, die vom Nordosten der Stadt ins Zentrum führt und wo sonst ab den frühen Morgenstunden der Verkehrslärm brummt, ist wie leergefegt. Einzig Militärfahrzeuge und bewaffnete Militärs befinden sich auf der Straße. Auf der Internetseite der Polizei müssen wir uns, bevor wir das Haus verlassen, ein Formular herunterladen. Wir sind uns einig, dass wir die Ruhe als angenehm und gleichzeitig ebenso unheimlich empfinden. Was das für die ambulanten Verkäufer*innen, die sonst an den Metro-Stationen und im Stadtzentrum Sandwiches, Sopaipillas und Müsli verkaufen, bedeutet, brauche ich denke ich sicher nicht erklären. Angestellte von Geschäften, die weiterhin geöffnet blieben, erhielten eine besondere Ausgangserlaubnis - und auch darüber gab es gemischte Meinungen. Wie immer, es ist kompliziert. Und besonders für die, die vorher bereits in prekären Arbeitsverhältnissen standen. Es werden wieder Ollas Comunes eingerichtet, solidarisches Kochen für alle, die plötzliche Verdienstausfälle erleiden.
Die weiteren Erzählungen berichte ich nur noch aus der Ferne, denn im April kam die Aufforderung zurückzufliegen. Zunächst dachte ich, dieser Aufforderung so schnell nicht nachkommen zu können, da keine Flüge mehr zu finden waren und auch das Rückholprogramm zunächst beendet schien. Dann geht es jedoch ganz plötzlich und ich fliege Ende April mit einem Rückholflug nach Amsterdam. Zurück in Deutschland werde ich ganz oft gefragt, wie „das mit Corona in Chile war” und möchte eigentlich am liebsten gar nicht drüber sprechen.
Im Juni schließlich tritt der nun Ex-Gesundheitsminister Jaime Mañalich zurück - was in den sozialen Medien unter den Unterstützer*innen der Proteste als Erfolg gefeiert wurde. Der Protest gegen die Regierung findet aufgrund weiter andauernder Ausgangssperren überwiegend virtuell oder durch Cazerolazos aus den Fenstern statt. Ich würde nicht sagen, dass der Widerstand gegen die neoliberale Regierung vom Virus überschattet wurde, vielmehr traten durch das Corona-Virus einige Punkte noch deutlicher hervor. Steigende Femizide und Angriffe auf Mapuche sind im Sepember, bei Abschluss dieses Berichts, im Bekanntenkreis der Verfasserin die überwiegenden Themen. Gerade werden die strengen Ausgangssperren langsam gelockert und ich sehe wieder Instagram-Stories meiner chilenischen Freund*innen außerhalb ihrer eigenen vier Wände. Meine Mitbewohnerin sagt zu mir: „Jetzt dürfen wir wieder raus - als wären wir Kinder, aber das Virus ist noch genauso da und nichts ist unter Kontrolle”. Malls, Restaurants und Bars sind wieder geöffnet - einige Parks bleiben aber weiter geschlossen. Man könnte meinen, die Kreditkarte schütze am besten vor COVID-19.
Zurück in Hamburg empfinde ich es als befremdlich, wie stark der Diskurs sich darum dreht, was man darf und was man nicht darf. Als würde die Ansteckungsgefahr erst bei Vorliegen einer Ordnungswidrigkeit steigen. Es wird viel von Freiheit und Grundrechten im Zusammenhang mit dem „Lockdown” gesprochen. In Santiago begegnete mir das viel weniger. Klar, vielleicht nutzt die eine oder andere die vierstündige Ausgangserlaubnis zum Einkaufen auch noch für einen Spaziergang durch das Viertel. Natürlich sind meine Erfahrungen zeitversetzt - den Anfang der Pandemie, wo bei vielen die Angst vielleicht noch präsenter war, verbringe ich in Santiago, wo zudem Vieles, unter anderem die nächtliche Ausgangssperre, die Menschen an die vergangene Militärdiktatur erinnert. Und jetzt, in der neuen Normalität, bin ich zurück in Hamburg - mit Junggesellinnen-Abschiedsgrüppchen im Rosa Tüllrock in der U-Bahn.
Und an der Plaza Dignidad, ehemals Plaza Italia, wird wieder demonstriert - mit Abstand und Maske. Es sind weniger Demonstrant*innen, die Wasserwerfer sind trotzdem da.
María Guadalupe Rivera Garay/ Gilberto Rescher (19.06.2020): Der Wert der als Unqualifiziert geltenden: Wie Migranten plötzlich systemrelevant werden
Der Wert der als Unqualifiziert geltenden: Wie Migranten plötzlich systemrelevant werden
María Guadalupe Rivera Garay und
Gilberto Rescher
19.06.2020
 |
María Guadalupe Rivera Garay, gebürtige Mexikanerin aus dem Valle del Mezquital, promovierte im Fach Soziologie an der Universität Bielefeld und lehrt an der Universität Hamburg im Bereich der Lateinamerika-Studien. |
 |
Gilberto Rescher ist Soziologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lateinamerika-Zentrum der Universität Hamburg sowie Koordinator der Hamburger Lateinamerika-Studien. Seine Forschungsschwerpunkte umfassen (Lokal-)Politik, Entwicklung, Migration, Transnationalität/Translokalität, indigene/ethnische Gruppen, Gender und qualitative Methodologie. |
Für einige von uns ist diese Zeit etwas surreal, denn plötzlich ändern sich Erkenntnisse wie man es nie erwartet hätte. Politiker in einigen Ländern Europas wie auch in den USA loben Migrant*innen und Saisonarbeiter*innen (in den USA sogar Migrant*innen ohne Papiere), erkennen sie als wichtig an, und deklarieren sie für essentiell und systemrelevant für die Versorgung ihrer Länder.
Boris Johnson, der britische Ministerpräsident, bedankte sich öffentlich besonders bei zwei Migrant*innen, der Krankenpflegerin Jenny aus Neuseeland und dem Pfleger Luis aus Portugal, die sich während seines Aufenthalts im Krankenhaus aufgrund seiner Covid-19-Erkrankung intensiv um ihn gekümmert hatten. Damit erkannte er an, wie wichtig und relevant die Arbeit solcher Menschen im Gesundheitssektor Großbritanniens ist. Eine ironische Wendung, hatte er doch vor nicht einmal drei Monaten noch eine ganz andere Meinung vertreten. Als essentielles Element des Brexit kündigte er damals die Schließung der Grenzen Großbritanniens und eine strengere Visa-Politik an, besonders für Menschen wie Jenny und Luis und andere, die nicht als Hochqualifizierte gelten. Schließlich war der Diskurs der Verhinderung von sogenannter unqualifizierter Migration offenbar generell eine der treibenden Kräfte auf Seiten der Brexit-Befürworter gewesen, die diese als wirtschaftlich unnötig und damit unerwünscht deklarierten.
In Deutschland kämpften gleichzeitig Bäuerinnen und Bauern darum, dass die Regierung die Einreise von Erntehelfer*innen aus Osteuropa ermöglichte, da sonst ihre Ernten besonders an Spargel und Erdbeeren verloren gehen würden. Sozialverbände beklagten derweil, dass Pflegekräfte aus Polen und anderen osteuropäischen Ländern wegen der Corona-Pandemie das Land verließen oder andere aufgrund von Einreisebeschränkungen oder auch schlicht aus Sorge nicht zum „Schichtwechsel“ nach Deutschland kamen und es daher einen Mangel an Arbeitskräften insbesondere in der privaten Altenpflege gibt. In Spanien und Italien, Länder die besonders von Covid-19 betroffen sind und für die die Landwirtschaft ein wichtiger ökonomischer Sektor ist, wird seit Wochen ein Mangel an Arbeitskräften beklagt, die normalerweise aus nordafrikanischen Staaten, Rumänien oder Bulgarien stammen und wegen der Epidemie nur schwer einreisen können. Daher befürchten viele Bäuerinnen und Bauern den Verlust ihrer Ernte, somit eine Katastrophe in der Landwirtschaft und schwere Schäden für die gesamte Ökonomie. In Portugal wurde sogar relativ früh eine Art Amnestie dekretiert, durch die allen registrierten irregulären Migrant*innen, Asylbewerber*innen, Geduldeten etc. der gleiche Zugang zum Gesundheits- und zum Sozialsystem wie portugiesischen StaatsbürgerInnen gewährt wird, wenn auch vermutlich nur temporär.
Nebenbei verrät Donald Trump in den USA selbst klammheimlich seine eigene Migrationspolitik und seine nationalistisch-protektionistische Haltung, die durch die bekannten Aussagen im Sinne von „America First“ hinlänglich charakterisiert wurde. Plötzlich benennt er die Tätigkeiten in der Landwirtschaft, die in der Mehrheit von irregulären Migrant*innen aus Mexiko und in geringerem Maße aus anderen lateinamerikanischen Ländern übernommen werden, als unverzichtbar und grundlegend für die Versorgung. Dazu fordert er Erntehelfer auf, besonders aus Zentralamerika, sich in ihren Ländern zu mobilisieren und Visumsanträge nachzureichen, damit sie so schnell wie möglich in den USA arbeiten können. Ärzt*innen und Krankenpfleger*innen, die bereits auf ein Visum warten, sollen sofort in die USA einreisen dürfen und direkt in das Gesundheitssystem einsteigen. Er deklariert nun „Wir schließen nicht unsere Grenzen, ihr sollt kommen, ich habe den Farmern mein Wort gegeben.“
Solche surreal wirkenden Diskurse und Aufrufe hören wir alltäglich in Zeiten von Corona. Migrant*innen, Erntehelfer*innen, Krankenpfleger*innen, Ärzt*innen, Kassierer*innen, LKW-Fahrer*innen werden gelobt, gebraucht und sogar Erntehelfer*innen mit Sonderflügen aus ihren Ländern geholt. Die Frage hier ist, ob diese Menschen und ihre Arbeitsbereiche nachhaltig anerkannt und ihre Leistung gerecht entlohnt werden. Ob bspw. Erntehelfer*innen ohne Papiere, die in den USA, Spanien, Italien, Großbritannien oder Deutschland bisher unter mehr oder weniger prekären Bedingungen arbeiten und verhältnismäßig schlecht bezahlt werden, einen legalen Status erhalten. Oder ob sich für Krankenpfleger*innen die Arbeitsbedingungen verbessern und sie angemessener bezahlt werden. Bisherige Erfahrungen zeigen uns leider, dass solche Bereiche und Menschen, obwohl sie immer für das System relevant gewesen sind und in Krisenzeiten als essentiell wichtig anerkannt werden, später wieder in ihre alte Position zurückgedrängt werden. Wir befürchten, dass dies auch diesmal der Fall sein wird, denn zum einen beweisen soziale Gefüge, und damit auch ökonomische wie politische Ordnungen, eine große Stabilität. Nach Krisenzeiten bleiben gewisse Änderungen erhalten, sie werden aber grundlegend in die bisherige Rationalität der Gesellschaft, in die soziale Ordnung der Verhältnisse, eingebettet. Beispiele dafür finden sich im Migrationskontext mit dem Ende des Bracero-Programms, mit dem während des zweiten Weltkriegs mexikanische Arbeitskräfte für die USA angeworben wurden oder auch dem Auslaufen der sogenannten Gastarbeiterprogramme in Deutschland.
Zum anderen und vermutlich viel bedeutender bemisst sich der ökonomische Wert der Leistung dieser Menschen ja in der Regel gerade durch die Prekarität und häufig die Illegalisierung dieser Menschen. Schließlich wird es in der Regel erst durch ein entsprechendes Arrangement möglich Menschen zu Arbeitsverhältnissen zu bewegen, die nicht dem entsprechen, was Angehörige der Gesellschaft akzeptieren, zu im Vergleich niedriger Entlohnung und problematischen Arbeitsbedingungen, die sich oft aus den Bedingungen des Arbeitsfeldes ergeben, aber auch aus einem ökonomischen Druck, den wir alle über Erwartungen an Preise mitverantworten.
Dies funktioniert nur, und das ist unser zentraler Punkt, durch eine fortlaufende Abwertung der Kenntnisse und Fähigkeiten dieser Gruppen. Ihnen wird in der allgemeinen Wahrnehmung ihr Wissen abgesprochen, ihre Tätigkeiten werden als einfach abgestempelt und sie selbst als unwissend, ohne jegliche Spezialisierung und damit letztlich als unqualifiziert konstruiert. Ein nicht ungewöhnliches Phämonen der, vereinfacht gesagt, Ausblendung, das in der Soziologie als „System des Nichtwissens“ bezeichnet wird.
Nun stellt die Welt plötzlich fest, dass sie nicht einfach zu ersetzen sind und eben doch über teils sehr spezielles Wissen verfügen. Nicht zu Unrecht verweist Margarete Stokowski in ihrem Artikel bei Spiegel-Online darauf, dass in Zeiten von Corona sichtbar werde, was bezogen auf Migration und Solidarität relevant sei, denn wenn nur 50 gefährdete Minderjährige aus griechischen Flüchtlingslagern geholt, dagegen aber 80.000 Erntehelfer eingeflogen werden, stünden im Mittelpunkt nicht der Mensch und die Gesellschaft, sondern die Rettung der jetzigen Wirtschaftsweise. In diesem Sinn sind die aktuellen o.g. Diskurse und Aufrufe von politischen Verantwortungsträgern vorrangig politisch und wirtschaftlich motiviert. Obwohl sie an unsere gesellschaftliche Solidarität und Verantwortlichkeit appellieren und diskursiv Wertschätzung für bisher in Arbeitshierarchien und der sozialen Strukturierung weit unten angesiedelte Menschen ausdrücken, zeigt die reale Politik diverser Länder, dass letztlich schlicht ökonomische Interessen im Zentrum stehen. Hier ist Stephan Lessenich zuzustimmen, wenn er in seinem Gastbeitrag für die Frankfurter Rundschau schreibt, dass die neue Solidarität Grenzen habe und eigentlich altem Konkurrenzdenken folge. Wir können also feststellen, dass sich, trotz schöner klingender Diskurse, die bisherige Logik unseres Systems nicht zwingend grundlegend ändern wird.
Nichtsdestotrotz erkennen wir Menschen, dass wir in Zeiten von Krisen sehr solidarisch sein können. Das haben wir in Deutschland zuletzt 2015 bei der Aufnahme von Geflüchteten in Deutschland erlebt, (wenn auch von vielen als „Flüchtlingswelle“ verunglimpft) als zahlreiche Menschen aus allen gesellschaftlichen Gruppen erklärten, Flüchtende zu unterstützen und mit offenen Armen willkommen zu heißen. Jetzt erleben wir wieder breites solidarisches Handeln, wenn Menschen sich gerne für andere organisieren und bspw. für Ältere einkaufen oder Landwirten bei der Ernte helfen wollen, da diese durch den möglichen Verlust ihrer Ernten grundlegend in ihrer Existenz bedroht sind. Wir denken aber, dass es jetzt auch ein wichtiger Beitrag von uns als Bürger*innen wäre, die Bedeutung der Arbeit der oben genannten Gruppen zu erkennen und von der Politik eine stärkere Anerkennung einzufordern, die nicht nur, wie oben beschrieben jetzt in der Krise geäußert wird, sondern jenseits dieser Diskurse nachhaltig sein muss. Landwirte berichten, dass sie von solcher Solidarität sehr berührt waren, aber letztlich auf Erntehelfer angewiesen sind, um ihre Ernten zu retten. Diese verfügen über spezifische Erfahrungen und Wissen verfügen, das freiwilligen Helfer*innen aber auch Arbeitslosen oder Asylbewerbern, auf die staatliche Stellen als Ersatz verwiesen haben, in der Regel fehlt. Wir müssen jetzt endlich verstehen, dass nicht einfach jeder Spargel, Erdbeeren oder später im Jahr Weintrauben ernten kann. Dafür wird außer der reinen Arbeitskraft auch viel Erfahrung, Disziplin und Flexibilität benötigt, also eine spezifische Qualifikation, die bisher kaum anerkannt wird. Die nötigen Eigenschaften und Kenntnisse finden sich eben bei den meist geringgeschätzten Arbeiter*innen aus Osteuropa oder im Falle der USA aus Mexiko, sei es in Bezug auf Landwirtschaft oder auf Pflege oder viele andere Bereiche, und diese Qualifikation nimmt besonders in den Gruppen zu, die seit langem hier arbeiten. Dazu kommt die Verlässlichkeit dieser Arbeiter*innen. Dies ist sicher einer der Gründe dafür, warum häufig von Freundschaften zwischen Landwirten und anderen Arbeitgebern und ihren (irregulären) Beschäftigten oder zumindest den Vorarbeitern gesprochen wird, auch wenn sich dies nicht unbedingt in einer Veränderung der Arbeitsbedingungen ausdrücken kann, weil ja „konkurrenzfähig“ produziert werden muss.
Es ist ersichtlich, dass es sich für die Landwirte nicht um einen kurzen Zeitraum handelt, sondern es um die Existenz ihrer Höfe geht, da jetzt zwingend die Ausgaben für das ganze Jahr erwirtschaftet werden müssen. Daher entsprechen die Vorschläge, die nun von staatlicher Seite gemacht wurden, nämlich arbeitslose Personen oder solche, deren Arbeitsbereiche aktuell durch die Krise betroffen werden, als Erntehelfer einzusetzen, nicht der Realität der landwirtschaftlichen Arbeit, und Entsprechendes gilt für die Pflegearbeit. Denn im Fall der Landwirtschaft sind die Tätigkeiten mit einem bestimmten Wissen verknüpft, das aufgrund von Erfahrungen entsteht und im Sinne der Soziologie Wissensreservoirs bildet sowie mit Reziprozitätsbeziehungen, gegenseitigem Verständnis, umfassender zeitlicher Verfügbarkeit und flexiblen Abmachungen zwischen Arbeitgebern und Beschäftigten. Im Fall der Krankenversorgung und der Pflege älterer Menschen ist dies wiederum stark an die Höhe der Löhne und die Arbeitsbedingungen gebunden. 24 Stunden pro Tag zur Verfügung zu stehen, das wird normalerweise nur von Migrant*innen akzeptiert. Die Erntearbeit ist körperlich höchst anstrengend, wird durch Wetterbedingungen erschwert und nur Menschen mit entsprechender Erfahrung und spezifischem Wissen können solch extrem lange Arbeitsschichten und die Arbeitsbedingungen überhaupt ertragen. Die Arbeiter*innen aus dem Osten Europas sowie mexikanische und zentralamerikanische Migrant*innen in den USA haben diese Erfahrung nach und nach aufgebaut und ihre Handlungsmacht genutzt, um mit ihren Arbeitgebern im Laufe der Jahre Arbeitsbeziehungen auszuhandeln und die Situation für sich angemessen zu gestalten und damit aus ihrer Perspektive erfolgreich zu sein. Daher ist es notwendig, dass wir als Bürgerinnen diese Arbeit und Leistung auch jenseits der Krise anerkennen, denn sie werden nach dieser Phase ja weiterhin in Supermärkten, auf den Feldern und den Gewächshäusern, in der Lebensmittelindustrie und auf Baustellen arbeiten, als Hilfskräfte in Restaurants spülen oder Mahlzeiten vorbereiten, Krankenhäuser und Schulen putzen oder unsere Eltern und Großeltern pflegen. Die Pandemie macht sichtbar, dass es nicht darum geht, diese Arbeitskräfte durch arbeitslose oder unterbeschäftigte Personen zu ersetzen und auch nicht darum sie bloß in Krisenzeiten zu rufen und wertzuschätzen, sondern darum auch nach der Krise anzuerkennen, dass sie und ihr Beitrag zu unserer Wirtschaft und Gesellschaft unverzichtbar sind. Soziologisch ausgedrückt, müssen hier durch uns alle ein System des Nichtwissens konfrontiert werden, das der mangelnden Anerkennung zugrunde liegt. Wir hoffen, dass dies nach der Pandemie in unserer kollektiven Erinnerung bleibt.
Lorrena Berrazueta/ Leon Schepers (03.05.2020): Ecuador und die Covid-19-Pandemie: Ein Interview | Ecuador y la pandemia de Covid-19
Dieser Text ist in zwei Sprachen verfügbar:
Este texto está disponible en dos idiomas:
Español
Ecuador y la pandemia de Covid-19: Una entrevista con la socióloga Lorena Berrazueta
Lorena Berrazueta y
Leon Schepers
03/05/2020
(Las preguntas fueron respondidas por escrito)
 |
Lorena Berrazueta, socióloga de profesión, ha trabajado en varias instituciones públicas y también en varias organizaciones privadas sin fines de lucro que tiene presencia en Ecuador (ONG). Trabajó en el Municipio de Quito ocho años, luego en el Ministerio de Inclusión Económica y Social en un departamento que trabaja directamente con las personas que reciben el Bono de Desarrollo Humano desde el año 2014 hasta el 2017, en el año 2018 trabajó como coordinadora de Levantamiento de Fondos en World Vision Ecuador, en el año 2019 fue asesora del Ministro de Educación. Al momento trabaja como consultora independiente con el Contrato Social por la Educación. |
 |
Leon Schepers, estudiante de Literatura Románica de la Universidad de Hamburgo, está escribiendo actualmente su tesis de maestría y trabaja como asistente académico en el Departamento de Estudios Latinoamericanos. El contacto con la familia de Lorena existe desde un intercambio de estudiantes en 2009. |
1. ¿Cuándo fue la primera vez que se dio cuenta de que el virus también podría afectar su país? ¿Al notar la gravedad de los posibles efectos para el país y la propia vida diaria, cómo fueron las primeras impresiones y, tal vez, cambios notables entre la gente alrededor?
En el Ecuador las alertas sobre la llegada del CORONAVIRUS se conocieron muy tarde, en principio las autoridades no tomaron en serio la posibilidad de que esta pandemia implicaría un gran problema de salud pública.
Los efectos en el país han sido devastadores, se han evidenciado los problemas de desigualdad. No es lo mismo afrontar una “cuarentena”, una prohibición de salir de casa por casi 50 días en familias de clase media, media alta y alta que en familias pobres o extremo pobres que viven de una economía de subsistencia, con apenas 1,00 dólar al día, en un solo cuarto siete personas, en donde no hay accesibilidad a servicios básicos, en donde muchas veces el simple lavado de manos es casi imposible.
El sistema de salud pública en el Ecuador ha demostrado todas sus falencias en esta crisis, aún luego de casi dos meses no se encuentra la mejor manera de afrontarla. En el país no se ha identificado el cómo hacer un cerco epidemiológico ni en las ciudades mucho peor en el campo, las pruebas de COVID-19 son absolutamente insuficientes para la cantidad de población. Es tan grave la situación que la cifras que entrega el gobierno sobre el número de casos no es confiable.1
Para todos, esta ha sido una experiencia muy traumática, los que pudimos, nos hemos aislado de la vida pública, de hacer una vida normal hemos pasado a una vida de confinamiento, además con una sensación de que el volver a la “nueva normalidad” no es seguro.
No conocemos aún el “Plan de Retorno” a la nueva vida, la curva de contagios en Ecuador no llega a la fase de aplanamiento, fuera de las cifras oficiales se reportan miles de casos al día de personas afectadas especialmente en Guayaquil y desde hace pocos días en Portoviejo – ciudad intermedia de la Costa, en la provincia de Manabí afectada por el terremoto-.
2. ¿De qué manera se ha cambiado la vida diaria y el trabajo propio? ¿Cómo son las medidas oficiales del gobierno y las restricciones para la vida pública?
Como señale anteriormente, la vida diaria ha cambiado de manera radical, pasamos de manera abrupta a “estar en casa”, eso significó que abandonamos la vida pública. En mi caso, al momento se han estancado mis planes de buscar un nuevo trabajo hasta analizar las posibilidades que se presenten en la nueva situación del país.
El gobierno impuso medidas de restricción desde hace 45 días, las mismas han sido cumplidas irregularmente por la población. Ha habido mucha desobediencia civil en los lugares de aglomeración de población (ferias, mercados; etc.), esto ha ocasionado un incremento de personas afectadas con coronavirus.
Muchos sectores vinculados a la producción (comerciantes, constructores; etc.), hacen presión al Gobierno Nacional y a los Gobiernos Locales para iniciar actividades el 4 de mayo. Este tema está en entredicho porque no se visualiza la acción del Estado y tampoco hay directrices precisas y exactas.
3. ¿Cómo es la situación actual en los hospitales en cuanto a pruebas disponibles, ropa de protección y equipamiento del personal sanitario, y carga de trabajo?
Para el 22 de marzo, los hospitales y las clínicas privadas de Guayaquil ya estaban colapsadas y sin posibilidad alguna de recibir ni un paciente más. Todo está lleno y las Emergencias se repletan con personas que no pueden respirar.
- ¿Por qué en menos de una semana el sistema de Salud de Guayaquil ya no pudo más?
- ¿Pudo haber estado mejor preparado el sistema hospitalario?
- ¿Se pudieron evitar muchas de las muertes que se dieron dentro de las casas de los enfermos, porque no fueron recibidos en ninguna casa de Salud
Las respuestas que tengo es que sí era posible hacer mucho mejor las cosas. Y estaba en las manos de las autoridades del gobierno realizarlo.
En otras ciudades como en Quito aún no es tan caótica la situación, y los hospitales públicos y privados no están colapsados, pero debo señalar que el Gobierno no ha dotado al personal de salud de los implementos necesarios para su protección ni para la atención. Los hospitales no cuentan con los implementos para una atención adecuada a los pacientes con COVID-19 que acuden ya con graves problemas respiratorios. Las unidades de terapia intensiva que tienen respiradores son insuficientes
 |
Hospital Teodoro Maldonado en donde se grabaron videos macabros con cadáveres en fundas negras amontonados en el piso. |
El coronavirus golpeó más en Guayaquil porque la ciudad ya era víctima, desde años atrás, de otro virus invisible: la corrupción. Tanto era así que apenas un mes antes que ataque la pandemia, el 19 de febrero, el Contralor Pablo Celi declaraba que los hospitales Teodoro Maldonado, Los Ceibos y Guasmo Sur entraban a una vigilancia especial por las irregularidades y malversación de recursos que se cometían en sus contrataciones. Justamente estos tres hospitales fueron los designados por el gobierno para recibir a los enfermos de Covid-19 en esta emergencia y son estos tres hospitales en donde más han fallecido las víctimas del Coronavirus en Guayaquil.
Fue en el Teodoro Maldonado en donde se grabaron videos macabros con cadáveres en fundas negras amontonados en el piso; fue en el hospital del Guasmo en donde se denunció que para encontrar el cuerpo de un fallecido, sus familiares tenían que pagar hasta USD 100 a un “gestor”; fue en el hospital de Los Ceibos en donde a un periodista que agonizaba le robaron su billetera, celular y reloj y hasta después de haber muerto, seguían sacando dinero de su cuenta con la tarjeta de débito que le habían sustraído.
Con los antecedentes que traían estos hospitales, lo que ha pasado durante la pandemia parece una secuela del modus operandi de la corrupción que ya mandaba en su interior.
4. ¿Cuáles consideran usted las causas/razones por las que Ecuador, más bien la provincia de Guaya, está afectado tan fuerte por la pandemia en comparación de otros países latinoamericanos, a pesar de que, aparentemente, había medidas muy estrictas y tempranas de las autoridades? ¿Algunos periódicos alemanes hablan de la “Italia latinoamericana “refiriéndose a Ecuador, creen usted que esta comparación sería adecuada?
Debo decir que lo que ha pasado en Guayaquil es la mayor tragedia en 500 años, especialmente el 4 de abril ha quedado marcado como el día récord de la muerte en toda la historia de Guayaquil y la provincia del Guayas, porque 677 personas no pudieron más con la enfermedad. De estos, más de 600 únicamente en Guayaquil.
Esta fecha es solamente un detalle para el registro porque la realidad en conjunto se multiplicó hasta llegar al 30 de abril a una cifra que suena irreal: más de 10.000 padres, madres, hijos, hermanos, ricos y pobres, gerentes y obreros, trabajadores y desempleados, o sencillamente hombres y mujeres que todavía tenían una vida por delante, 10.000 de ellos murieron en los meses de marzo y abril de este año 2020 como el efecto mortal de la pandemia del coronavirus en esta zona bautizada sin acta como el Gran Guayaquil y que incluye a Durán, Daule y Samborondón, eternos vecinos y ahora hermanos en el dolor.
 |
Cementerio público de Guayaquil en donde fueron depositados los restos de 10.000 personas que han muerto en los meses de marzo y abril de este año 2020 como el efecto mortal de la pandemia del coronavirus. |
La cifra es la más alta que se pueda encontrar en los archivos, pero es estrictamente apegada a la realidad de las inscripciones de defunciones que trae el Registro Civil del Ecuador. Y estremece más cuando se compara con Wuhan, la cuna de la epidemia en China, que registra 3869 fallecimientos por Covid-19 hasta la fecha. O con Brasil, que, con 210 millones de habitantes, hasta fines de abril contó 5901 muertos, siendo Sao Paulo la ciudad más afectada. Inclusive con Nueva York, que teniendo más muertos, su incremento de mortalidad es del 341% frente al 485% que registra Guayas, incluida Guayaquil, ubicándose con esa cifra como la urbe más golpeada por el coronavirus en el mundo. Hasta ahora y tomando como base las estadísticas de marzo y abril.2
Investigando un poco, lo que sucedió en Guayaquil me atrevo a decir que fueron varias situaciones las que confluyeron:
I. Los Retornados
La migración jugó en contra. Y la casualidad hizo que justo en un mes de vacaciones para toda la Costa, febrero, el virus aterrizó en el país adentro de los cuerpos de algunos de los miles de viajeros que arribaron por el aeropuerto José Joaquín de Olmedo. Y no fue precisamente el 14 de febrero, con la tantas veces mencionada y publicada en redes Paciente Cero, la señora migrante de Babahoyo que llegó de España y tuvo las típicas recepciones sociales de bienvenida, como es la costumbre. Pero la Paciente Cero no fue la responsable de la expansión del virus en Guayaquil.
 |
Mesa de información del Ministerio de Salud Pública del Ecuador en el Aeropuerto “José Joaquín de Olmedo” – Guayaquil. |
Luis Sarrazín, ex ministro de Salud y parte del equipo de expertos conformado por el municipio de Guayaquil dice con certeza que: el brote de coronavirus en Guayaquil se originó en Samborondón. Y lo explica en que muchos de sus habitantes de clase alta y media alta, habían regresado de sus vacaciones en Europa y Estados Unidos. Algunos de ellos, contagiados. Luego participaron en eventos sociales y otras actividades en donde diseminaron el virus, tanto entre invitados como entre empleados. “Debido al desorden completo de sus habitantes se diseminó la pandemia de una forma rápida”, dijo Sarrazín. Esto lo confirmó en su momento el gobernador del Guayas, Pedro Duart, quien indicó que muchos ciudadanos de Samborondón “continuaron haciendo lo que les daba la gana y no acataron las medidas cuando ya fue decretada la pandemia”. Y es que la entrada del coronavirus por el aeropuerto Olmedo fue libre. Tanto, que los infaltables bromistas de las redes hicieron un meme del solitario empleado sanitario a quien el Ministerio de Salud le puso una escuálida mesa de control a la salida del aeropuerto. “Nos fallaste flaco”, decía el chiste.
 |
„Nos fallaste flaco.“ (Twitter 29/02/20) |
Gracioso y todo, la imagen era un reflejo de la precariedad del cerco epidemiológico que se intentaba aplicar esos días con un flujo intenso de viajeros retornados. Casi nada. El dichoso control epidemiológico resultó un espejismo, dice el periodista Cristian Zurita. “Mientras funcionarios armaban un discurso técnico sobre el cerco que rodeaba a la paciente cero, a Guayaquil entraban centenas de personas de todas las latitudes del mundo”. Algo que complementa el médico salubrista Esteban Ortiz. “Con la llegada de los migrantes, eso implicaba una reunión social, la bienvenida. Eso es una tradición”, lo que propagó a una velocidad inusitada el virus y determinó que en apenas quince días o tres semanas el nivel de contagio haya llegado a picos no calculados por nadie.
II. El dengue. Un virus nuevo cayó en tierra con un virus viejo
La primera noticia al respecto al dengue nos llegó desde Londres, en una publicación de la BBC: «La pandemia de covid-19 llega a América Latina cuando otras epidemias y brotes que han azotado a la región por generaciones siguen estando allí», dijo a BBC Mundo la doctora Josefina Coloma, investigadora de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de California, Berkeley, y miembro del comité asesor de la OPS. «Este es el problema de la llamada ‘doble carga’ de dos enfermedades, como dengue y covid-19, que se pueden dar al mismo tiempo, en las mismas personas y en los mismos lugares». Y eso es lo que podría estar ocurriendo en Guayaquil, dice la investigadora.
III. Falta de decisión de las autoridades
Las autoridades comenzaron a dar discursos llamando a la tranquilidad y así comenzó marzo, intentando llevar las actividades de la manera más normal posible, como si ningún virus hubiese llegado a la ciudad. Con esa lógica se autorizó la presencia del público para el partido del 4 de marzo de Copa Libertadores Barcelona-Independiente, al que acudieron casi 20 mil personas. Fue una medida polémica porque el 29 de febrero el Ministerio de Gobierno había dispuesto lo contrario y se dejó sin efecto la prohibición para Guayaquil. “El peor virus es el miedo”, sentenció entonces el gobernador del Guayas Pedro Duart. En Italia, los especialistas han dicho que la realización del partido de la Champions Atalanta-Valencia, que se jugó el 19 de febrero en Milán, tuvo los efectos de una “bomba biológica”, al ser señalado como el gran detonante de la pandemia en Italia y España, considerando que los equipos eran de esos países al igual que los hinchas que acudieron al estadio milanés San Siro.
En Guayaquil hasta ahora nadie ha dicho lo mismo del partido de Copa Libertadores, pues todos los comentarios se han centrado en el desastroso juego que presentó Barcelona esa noche. Pero la frase del gobernador Duart quedó marcada, aunque ahora él sostiene que “no creo que el partido sea el motivo para que se desprestigie mi trabajo en la Gobernación. Epidemiólogos están trabajando para conocer las verdaderas causas”.
Los miles de muertes duelen y seguirán doliendo por un largo tiempo, pero las escenas de los políticos, cada uno por su lado, intentando con sus acciones aisladas paliar los estragos de la pandemia y quedar bien al mismo tiempo, molestan, porque esos egoísmos finalmente sí causan daño, al desparramar esfuerzos que unidos podrían ser realmente efectivos y no lo que terminaron siendo, campañas débiles que no estuvieron listas con sus resultados en los momentos más cruentos de la tragedia.
5. ¿Qué va a pasar en las próximas semanas? ¿Ya ha pasado lo más grave o es sólo el comienzo de la pandemia? ¿Cuáles son los desafíos especiales o, a lo mejor también, ventajas, comparados con otros países para la población en cuanto a la condición del sistema sanitario, etc.?
"Vamos a pasar del aislamiento al distanciamiento". La ministra de Gobierno, María Paula Romo, anunció la mañana de este viernes 24 de abril del 20203 que Ecuador está próximo a cumplir la cuarentena y que, por lo pronto, a partir del 4 de mayo el país entrará en una etapa de "nueva normalidad" en medio de la crisis por el coronavirus. La medida implica la reactivación de sectores. "No podemos permanecer encerrados en casa", dijo Romo; sin embargo, enfatizó que esta nueva etapa no implicará un regreso a la vida como se conocía antes de la llegada de la pandemia del covid-19 al Ecuador. "No significa que vamos a volver a lo que era enero o lo que era febrero. Es una nueva normalidad lo que vamos a tener después del coronavirus. Las cosas se harán de forma muy paulatina". La semana del 27 de abril al 1 de mayo será de preparación para el diseño del plan de distanciamiento social; con estudios y definición de modelos para la reactivación de las actividades comerciales y laborales, y la definición del plan piloto para el sector de la construcción bajo cumplimiento de protocolos sanitarios. Eso significa que el semáforo continuará en rojo una semana más. A partir del 4 de mayo habrá actividades que se retomen con la vigencia del periodo de distanciamiento. "El gran desafío es la disciplina y la organización" dijo Romo. Hasta entonces, la instrucción para los ecuatorianos es la de permanecer en casa, pero desde el 4 de mayo las medidas van "a ser mucho más complicada" -puntualizó la ministra- porque los ciudadanos deberán "cumplir horarios, estar pendientes del semáforo, tener precaución en cambiar nuestros hábitos de tocar un pasamanos, una puerta, de darnos la mano. Llevar siempre mascarilla, la mascarilla bien puesta.
Las clases en escuelas y colegios continuarán desde casa: No se reabrirán centros educativos. El año lectivo en Sierra y Amazonía concluirá a distancia, tal como lo programó el Ministerio de Educación. ¿La "nueva normalidad" rige para todos los trabajos?
La próxima semana se definirá qué sectores retoman la jornada laboral presencial y quiénes continúan en teletrabajo, tanto en el sector público como privado. Quienes deban desplazarse a laborar, durante el nuevo período de distanciamiento, deberán guardar una distancia de al menos de 1,5 metros entre personas, en todos los espacios: transporte, oficina, industria. Según Romo, Ecuador está listo para dar este paso. "Hemos visto la etapa más dura, el rostro más duro de esta pandemia, pero podemos decir que ya pasó el pico en la mayor parte de las provincias del país".
El Ecuador espera cambiar de etapa, de instrucciones, pero no significa que la emergencia se haya terminado". Sin embargo, un descuido de la ciudadanía en la etapa de distanciamiento social podría generar una nueva aceleración en la curva de contagios.
La Ministra de Gobierno señaló que (…) cada, ciudadano, las empresas y las instituciones tendrán la próxima semana para organizarse y evitar que esto ocurra, dijo. Desde las autoridades se hizo un llamado a que las empresas fortalezcan sus departamentos de salud, para establecer procedimientos de control de la enfermedad. Las diferentes provincias del país enfrentarán esta nueva realidad de acuerdo con el semáforo.
De estas declaraciones realizadas debo precisar que:
- Aún el Ecuador no conoce el plan de retorno a la “nueva normalidad”.
- El Gobierno dejó a cada uno de los Municipios la decisión de levantar las restricciones, sin embargo, ninguno de los Gobiernos Locales en el Ecuador ha recibido las asignaciones presupuestarias para hacer frente a las dificultades que se presenten en relación a la crisis presupuestaria.
- Los sectores productivos empujan fuertemente por regresar a la “normalidad”, sin embargo, los planes de “retorno” también los ha generado cada uno de estos sectores.
- Estos 50 días de restricción en el país, ha dejado: i) más del 25% de personas del sector privado sin trabajo, ii) aproximadamente 30.000 empleados públicos despedidos, iii) de acuerdo a los datos de la policía se ha incrementado la delincuencia por la falta de empleo, iv) actividad comercial totalmente deteriorada.
[1] En Guayaquil, por ejemplo, antes de la pandemia había 1.200 fallecimientos al mes, en estos días se ha identificado que 10.000 personas han muerto.
[2] La Historia y Periodismo de Investigación | 02 de mayo del 2020 |Revista Digital.
[3] Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente dirección: El Comercio
Deutsch
Ecuador und die Covid-19-Pandemie: Ein Interview mit der Soziologin Lorena Berrazueta
Lorena Berrazueta y
Leon Schepers
03.05.2020
(Die Fragen wurden schriftlich beantwortet)
 |
Lorena Berrazueta, studierte Soziologin, hat in mehreren öffentlichen Institutionen und NGOs Ecuadors gearbeitet. So arbeitete sie acht Jahre lang in der Stadtverwaltung von Quito, dann von 2014-2017 im Ministerium für wirtschaftliche und soziale Eingliederung in einer Abteilung, mit Menschen arbeitet, die den Bono de Desarrollo Humano erhalten. 2018 arbeitete sie als Fundraising-Koordinatorin bei World Vision Ecuador, 2019 war sie Beraterin des Bildungsministers. Gegenwärtig arbeitet sie als unabhängige Beraterin für den Sozialpakt für Bildung. |
 |
Leon Schepers studiert Romanische Literaturen im Master an der Universität Hamburg und arbeitet als studentische Hilfskraft für den Fachbereich Lateinamerikastudien. Der Kontakt mit der Familie von Lorena besteht seit einem Schüleraustausch im Jahr 2009. |
1. Wann haben Sie zum ersten Mal erkannt, dass das Virus auch Ihr Land befallen könnte? Wie waren Ihre ersten Eindrücke als Ihnen das mögliche Ausmaß der Pandemie deutlich wurde? Haben Sie Veränderungen bei den Menschen in Ihrem Umfeld bemerkt?
In Ecuador waren die Warnungen vor der Ankunft des Virus erst sehr spät zu vernehmen. Anfangs nahmen die Behörden die Möglichkeit nicht ernst, dass diese Pandemie ein großes Problem für die öffentliche Gesundheit mit sich bringen würde.
Die Auswirkungen auf das Land sind verheerend, die Probleme der Ungleichheit sind sichtbar geworden. Quarantäne bedeutet nicht dasselbe, wenn du aus der Mittelschicht, gehobenen Mittelschicht oder Oberschicht kommst oder eben aus einer armen, bzw. extrem armen Familie, die am Existenzminimum wirtschaften und von kaum 1,00 Dollar pro Tag leben muss; mit sieben Leuten in einem Zimmer und ohne Zugang zu grundlegender Versorgung, wo selbst Händewachen fast unmöglich scheint.
Das öffentliche Gesundheitssystem in Ecuador hat in dieser Krise all seine Mängel aufgezeigt, und selbst nach fast zwei Monaten ist der beste Weg, ihr zu begegnen, nicht gefunden. Noch wurde kein Weg gefunden Städte oder ländliche Gebiete epidemiologisch abzuriegeln und die verfügbaren Tests auf das Virus sind absolut unzureichend bei dieser Anzahl der Bevölkerung. Die Situation ist so ernst, dass die offiziellen Zahlen der Regierung nicht mehr glaubwürdig sind.1 Für uns alle war dies eine sehr traumatische Erfahrung. Diejenigen von uns die konnten, haben sich vom öffentlichen Leben isoliert und sind von einem normalen Leben zu einem Leben mit Ausgangsbeschränkungen übergegangen. Auch mit dem Gefühl, dass eine Rückkehr zur „neuen Normalität“ nicht sicher sei.
Nach wie vor kennen wir den "Rückkehrplan" zu neuem Leben noch nicht, die Ansteckungskurve in Ecuador hat noch nicht die abflachende Phase erreicht und außerhalb der offiziellen Zahlen werden täglich Tausende von Fällen von Betroffenen gemeldet, besonders in Guayaquil und seit einigen Tagen in Portoviejo – eine Stadt an der Küste, in der vom Erdbeben betroffenen Provinz Manabi.
2. Wie hat sich Ihr tägliches Leben und Ihre Arbeit verändert und wie sehen die offiziellen Maßnahmen und Einschränkungen der Regierung für das öffentliche Leben aus?
Wie ich vorhin sagte, hat sich das tägliche Leben radikal verändert. Wir sind abrupt zum "Zuhause sein" übergegangen, und haben das öffentliche Leben aufgegeben. In meinem Fall sind meine Pläne, eine neue Arbeitsstelle zu suchen, nun ins Stocken geraten, bis ich die Möglichkeiten einschätzen kann, die sich aus der neuen Situation des Landes ergeben.
Die Regierung verhängte vor 45 Tagen Maßnahmen, die von der Bevölkerung unregelmäßig umgesetzt wurden. An Orten wo viele Menschen zusammenkommen (Messen, Märkte usw.) hat es viel zivilen Ungehorsam gegeben, was zu einer Zunahme der mit Coronaviren infizierten Menschen geführt hat.
Viele mit der Produktion verbundene Sektoren (Händler, Bauunternehmer usw.) üben Druck auf die nationalen und lokalen Regierungen aus, damit diese am 4. Mai ihre Tätigkeit wiederaufnehmen können. Die Frage bleibt unklar, da die Regierung ihr Handeln nicht transparent macht und es keine präzisen und exakten Richtlinien gibt.
3. Wie ist die aktuelle Lage in den Krankenhäusern hinsichtlich der Verfügbarkeit von Test, Schutzkleidung, medizinisches Personal und Arbeitsbelastung?
Bereits am 22. März waren die Krankenhäuser und Privatkliniken von Guayaquil zusammengebrochen und nicht mehr in der Lage, weitere Patienten aufzunehmen. Alles ist voll und die Notaufnahme überfüllt mit Menschen, die nicht atmen können.
Warum ist das Gesundheitssystem von Guayaquil nach einer Woche zusammengebrochen? Hätten die Krankenhäuser besser vorbereitet sein können? Hätten viele der Todesfälle vermieden werden können, wären sie in einer Gesundheitseinrichtung aufgenommen worden?
Meine Antwort darauf lautet: Ja, es man hätte vieles besser machen können und es lag in den Händen der Regierungsbehörden, dies zu tun.
In anderen Städten wie Quito ist die Situation noch nicht so chaotisch, und öffentliche und private Krankenhäuser noch nicht zusammengebrochen, dennoch muss ich darauf hinweisen, dass die Regierung das Gesundheitspersonal nicht mit den für seinen Schutz und seine Betreuung erforderlichen Geräten ausgestattet hat. Die Krankenhäuser verfügen nicht über die Mittel, um Patienten mit COVID-19, die bereits an schweren Atemwegsproblemen leiden, angemessen zu versorgen. Intensivstationen mit Beatmungsgeräten sind unzureichend vorhanden.
 |
Krankenhaus Teodoro Maldonado wo makabre Videos aufgenommen wurden, mit Leichen in schwarzen Säcken, die sich auf dem Boden stapelten. |
Das Coronavirus traf Guayaquil am härtesten, weil die Stadt bereits Jahre zuvor einem anderen unsichtbaren Virus zum Opfer gefallen war: der Korruption. So sehr, dass kaum einen Monat vor Ausbruch der Pandemie, am 19. Februar, der Rechnungsprüfer Pablo Celi erklärte, dass die Krankenhäuser Teodoro Maldonado, Los Ceibos und Guasmo Sur wegen Unregelmäßigkeiten und Veruntreuung von Ressourcen bei der Einstellung unter besonderer Beobachtung stünden. Genau diese Krankenhäuser wurden von der Regierung dazu bestimmt, die Patienten von Covid-19 in dieser Notlage aufzunehmen, und es sind diese drei Krankenhäuser, in denen am meisten Menschen an diesem Virus gestorben sind.
Es war im Teodoro Maldonado, wo makabre Videos mit auf dem Boden gestapelten Leichen in schwarzen Leichensäcken aufgenommen wurden; es war im Krankenhaus von Guasmo, wo berichtet wurde, dass seine Angehörigen bis zu 100 USD an einen "Manager" zahlen mussten, um die Leiche eines Verstorbenen zu finden; es war im Krankenhaus von Los Ceibos, wo einem sterbenden Journalisten seine Brieftasche, sein Mobiltelefon und seine Uhr gestohlen wurden, und selbst nachdem er gestorben war, wurde mit der gestohlenen Kreditkarte weiterhin Geld von seinem Konto abgehoben.
Mit dieser Vorgeschichte scheinen die Geschehnisse während der Pandemie bloß eine Fortsetzung des Modus Operandi der Korruption zu sein, die bereits in ihnen herrschte.
4. Was sind Ihrer Meinung nach die Ursachen und Gründe dafür, dass Ecuador, und vor allem Provinz Guayaquil, im Vergleich zu anderen lateinamerikanischen Ländern so stark von der Pandemie betroffen ist, obwohl die Behörden offenbar sehr strenge und frühzeitige Maßnahmen ergriffen haben? Einige deutsche Zeitungen sprechen vom "Italien Lateinamerikas", halten Sie diesen Vergleich für angemessen?
Ich muss sagen, dass das, was in Guayaquil geschehen ist, die größte Tragödie seit 500 Jahren ist. Insbesondere der 4. April ging als Rekordtodestag in der gesamten Geschichte von Guayaquil und der Provinz Guayas in die Geschichte ein, weil 677 Menschen mit der Krankheit nicht mehr zurechtkamen. Davon allein mehr als 600 in Guayaquil.
Dieses Datum ist nur ein Detail für die Aufzeichnung, denn insgesamt haben sich die Zahlen bis zum 30. April so stark vervielfacht, dass es unwirklich klingt: Mehr als 10.000 Väter, Mütter, Kinder, Brüder und Schwestern, Reiche und Arme, Manager und Arbeiter, Arbeiter und Arbeitslose oder einfach Männer und Frauen, die noch ein Leben vor sich hatten, 10.000 von ihnen starben in den Monaten März und April des Jahres 2020 in der Region, die ohne Zeremonie als „Gran Guayaquil“ getauft wurde und die Durán, Daule und Samborondón umfasst - ewige Nachbarn und jetzt Brüder und Schwestern im Schmerz.
 |
Öffentlicher Friedhof in Guayaquil, auf dem die sterblichen Überreste von 10.000 Menschen, die im März und April dieses Jahres 2020 in Folge der Coronavirus-Pandemie starben. |
Die Zahl ist die höchste, die in den Archiven zu finden ist, aber sie entspricht strikt der Realität der Todesfallregistrierungen, die vom Zivilregister Ecuadors vorgenommen werden. Und es ist umso schockierender, wenn man es mit Wuhan vergleicht, der Wiege der Epidemie in China, wo bis heute 3869 Todesfälle pro Covid-19 verzeichnet werden. Oder mit Brasilien, das mit 210 Millionen Einwohnern bis Ende April 5901 Tote zählte, wobei Sao Paulo die am stärksten betroffene Stadt war. Selbst in New York, das mehr Todesfälle zu verzeichnen hat, ist die Sterblichkeitsrate um 341% gestiegen, verglichen mit 485% in Guayas, einschließlich Guayaquil, und ist damit die Stadt, die weltweit am stärksten vom Coronavirus betroffen ist - basierend auf den Statistiken für März und April.2 Nach einiger Recherche zu den Vorkommnissen in Guayaquil, wage ich zu behaupten, dass es vielfältige Umstände waren, die die Situation dort beeinflusst haben:
I. Die Rückkehrer
Die Migration spielte dagegen. Und zufällig, nur einen Monat nach Beginn der Ferienzeit für die gesamte Küste, im Februar, landete das Virus in den Körpern einiger der Tausenden von Reisenden, die am Flughafen José Joaquín de Olmedo ankamen, im Land. In den Sozialen Netzwerken ist häufig die Rede von einer Patientin Null, einer Migrantin aus Babahoyo, die am 14. Februar aus Spanien angereist war und – wie es typisch ist – von vielen Menschen empfangen worden war. Doch die Patientin Null ist nicht verantwortlich für die Verbreitung des Virus in Guayaquil.
 |
Informationsschalter des ecuadorianischen Gesundheitsministeriums am Flughafen "José Joaquín de Olmedo" - Guayaquil. |
Luis Sarrazín, ehemaliger Gesundheitsminister und Teil des von der Gemeinde Guayaquil gebildeten Expertenteams, sagt mit Sicherheit: Der Ausbruch des Coronavirus in Guayaquil hat seinen Ursprung in Samborondón. Und er erklärt es damit, dass viele seiner Bewohner der Ober- und oberen Mittelschicht aus ihren Ferien in Europa und den Vereinigten Staaten zurückgekehrt waren. Einige von ihnen, infiziert. Anschließend nahmen sie an gesellschaftlichen Veranstaltungen und anderen Aktivitäten teil, bei denen sie das Virus unterGästen und Mitarbeitern verbreiteten. "Aufgrund der völligen Unordnung ihrer Bewohner breitete sich die Pandemie schnell aus", sagte Sarrazín. Dies wurde damals vom Gouverneur von Guayas, Pedro Duart, bestätigt, der darauf hinwies, dass viele Bürger von Samborondón "weiterhin taten, was sie wollten, und sich nicht an die Maßnahmen hielten, als die Pandemie bereits verordnet war. Und das liegt daran, dass die Einreise des Coronavirus über den Flughafen Olmedo problemlos möglich war. Sogar so sehr, dass die unfehlbaren Witzbolde der Netzwerke ein Meme für die einsame Gesundheitshelferin schufen, die vom Gesundheitsministerium am Flughafenausgang einen schmutzigen Kontrolltisch bekam. "Sie haben uns im Stich gelassen", hieß es im Witz.
 |
„Nos fallaste flaco.“ (Twitter 29/02/20) |
Zwar lustig, und dennoch spiegelte das Bild den verzweifelten Versuch wider, die epidemiologische Eingrenzung des starken Rückreisestroms durchzusetzen. Fast nichts. Die glückliche epidemiologische Kontrolle entpuppte sich als Fata Morgana, sagt der Journalist Cristian Zurita. “Während Beamte ihre technokratischen Reden über die Eindämmung um den Patienten Null hielten, kamen Hunderte von Menschen aus der ganzen Welt nach Guayaquil”. Dies ergänzte der Epidemiologe Esteban Ortiz so: „Die Ankunft der Migranten bedeutete auch ein geselliges Beisammensein, ein Willkommen. Das ist Tradition.”, die das Virus mit einer noch nie dagewesenen Geschwindigkeit verbreitete, sodass innerhalb von nur zwei oder drei Wochen das Ansteckungsniveau unberechenbare Höchstwerte erreicht hatte.
II. Das Denguefieber. Ein neues Virus im Land eines alten
Die ersten Nachrichten über das Dengue-Fieber kamen aus London in einer BBC-Publikation: "Die Covid-19-Pandemie kommt in Lateinamerika an, während andere Epidemien und Ausbrüche, die die Region seit Generationen geplagt haben, immer noch da sind", sagte Dr. Josefina Coloma, Forscherin an der School of Public Health der Universität von Kalifornien, Berkeley, und Mitglied des PAHO-Beratungsausschusses, gegenüber BBC Mundo. "Dies ist das Problem der so genannten 'Doppelbelastung' durch zwei Krankheiten, wie Dengue und Covid-19, die zur gleichen Zeit, bei den gleichen Menschen und an den gleichen Orten auftreten können. Und genau das könnte in Guayaquil geschehen, sagt die Forscherin.
III. Fehlende Entscheidungen der Behörden
Die Behörden riefen dazu auf die Ruhe zu behalten und so begann der März damit, das normale Leben so laufen zu lassen, als ob es das Virus nicht gebe. Dieser Logik folgend, wurde das Spiel der Copa Libertadores Barcelona-Independiente, an dem fast 20.000 Menschen versammelten. Es handelte sich um eine umstrittene Maßnahme, da das Regierungsministerium am 29. Februar das Gegenteil angeordnet hatte und das Verbot für Guayaquil aufgehoben wurde. "Das schlimmste Virus ist die Angst", sagte damals Guayas Gouverneur Pedro Duart. In Italien hatten Spezialisten gesagt, dass die Austragung des Spiels Atalanta-Valencia, das am 19. Februar in Mailand stattfand, die Auswirkungen einer "biologischen Bombe" hatte, da sie als der große Zünder der Pandemie in Italien und Spanien gilt, wenn man bedenkt aus welchen Ländern die Mannschaften und Fans der jeweiligen Clubs ins Mailänder San-Siro-Stadion kamen.
Niemand in Guayaquil hat bisher dasselbe über die Partie der Copa Libertadores gesagt, da sich alle Kommentare auf das katastrophale Spiel konzentrierten, das Barcelona an diesem Abend präsentierte. Aber Gouverneur Duarts Aussage war eindeutig, obwohl er jetzt behauptet: "Ich glaube nicht, dass das Spiel der Grund dafür ist, meine Arbeit im Büro des Gouverneurs zu diskreditieren. Epidemiologen arbeiten daran, die wahren Ursachen herauszufinden".
Die Tausenden von Toten schmerzen und werden es noch lange tun, aber die Szenen der Politiker, jeder auf seine Weise, die mit ihren isolierten Aktionen versuchen, die Verwüstungen der Pandemie zu lindern und gleichzeitig gut auszusehen, sind ärgerlich, weil dieser Egoismus schließlich Schaden anrichtet, indem er Bemühungen behindert, die zusammen wirklich effektiv sein könnten, und nicht das, was sie am Ende waren: schwache Kampagnen, die in den grausamsten Momenten der Tragödie noch nicht mit ihren Ergebnissen fertig waren.
5. ¿Was wird in den nächsten Wochen passieren? Ist das Schlimmste schon vorbei oder steht Ecuador noch am Anfang der Pandemie? Was sind die besonderen Herausforderungen, und vielleicht auch Vorteile, Ecuadors im Vergleich mit anderen Ländern für die Bevölkerung in Bezug auf das Gesundheitssystem, etc.?
"Lasst und von Isolation zu Distanz übergehen". Regierungsministerin María Paula Romo kündigte heute Freitagmorgen, 24. April 20203 , an, dass Ecuador kurz vor der Aufhebung der Quarantäne steht und dass das Land ab dem 4. Mai vorerst in eine Phase der "neuen Normalität" inmitten der Coronavirus-Krise eintreten wird. Die Maßnahme impliziert die Reaktivierung der Wirtschaftssektoren. "Wir können nicht zu Hause eingesperrt bleiben", sagte Romo. Er betonte jedoch, dass diese neue Etappe keine Rückkehr zum Leben wie man vor der Ankunft der Covid-19-Pandemie in Ecuador kannte, bedeuten werde. "Es bedeutet nicht, dass wir zu dem zurückkehren werden, was Januar oder Februar war. Es ist eine neue Normalität, die wir nach dem Coronavirus haben werden. Die Dinge werden sehr langsam vorangehen". In der Woche vom 27. April bis zum 1. May wird ein Plan zur sozialen Distanzierung entworfen; mit Studien und Entwürfen für die Reaktivierungsmodelle kommerzieller und arbeitsrechtlicher Aktivitäten sowie der Formulierung eines Pilotplans für den Bausektor unter Einhaltung der Gesundheitsprotokolle. Das bedeutet, dass die Ampel noch eine Woche lang auf Rot stehen wird. Ab dem 4. Mai wird es Aktivitäten geben, die unter Einhaltung der Abstandsregelungen wieder aufgenommen werden. " Die große Herausforderung sind Disziplin und Organisation", sagte Romo. Bis dahin lautet die Anweisung für Ecuadorianer, zu Hause zu bleiben, aber ab dem 4. Mai werden die Maßnahmen "viel komplizierter" sein. -so die Ministerin – denn die Bürger „müssen sich an einen Zeitplan halten, abhängig von einer Ampelregelung, und ihr Verhalten ändern, wie beispielsweise Handläufe berühren, eine Tür oder sich die Hand zu geben. Tragen Sie immer eine Maske, und zwar ordentlich aufgesetzt.“
Der Unterricht in Schulen und Hochschulen wird von zu Hause aus fortgesetzt: Bildungszentren bleiben geschlossen. Das Schuljahr in Sierra und Amazonía wird ohne Präsenz beendet, wie vom Bildungsministerium geplant. Gilt diese “neue Normalität” für alle Arbeitenden?
Nächste Woche wird festgelegt, in welchen Sektoren der Arbeitsalltag, sowohl im öffentlichen Dienst wie für die Privatwirtschaft, wieder aufgenommen werden kann und wer weiterhin aus dem Home-Office arbeiten wird. Diejenigen, die nun zur Arbeit müssen, sollen einen Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen den Menschen einhalten: Im öffentlichen Nahverkehr, im Büro, in der Fabrik. Laut Romo ist Ecuador zu diesem Schritt bereit. "Wir haben die schwerste Phase, das schwerste Gesicht dieser Pandemie gesehen, aber wir können sagen, dass der Höhepunkt in den meisten Provinzen des Landes überschritten ist. Ecuador hofft, die Auflagen zu lockern, aber das bedeutet nicht, dass die Notlage vorbei ist. Eine Vernachlässigung der Bürgerschaft in der Phase der sozialen Distanzierung könnte jedoch eine neue Beschleunigung der Ansteckungskurve bewirken.
Die Regierungsministerin sagte, dass [...] jeder Bürger, jedes Unternehmen und jede Institution die nächste Woche Zeit haben wird, sich zu organisieren, um einen erneuten Ausbruch zu verhindern, sagte sie. Die Behörden forderten die Unternehmen auf, ihre Gesundheitsabteilungen zu stärken, um Mechanismen der Gesundheitskontrolle einzuführen. Die verschiedenen Provinzen des Landes werden sich dieser neuen Realität entsprechend des Ampel-Systems stellen.
Ausgehend von diesen Aussagen muss ich darauf hinweisen:
- Ecuador hat noch keinen Plan, um zur „neuen Realität“ zurückzukehren.
- Die Regierung überließ es den einzelnen Gemeinden, zu entscheiden, ob sie die Beschränkungen aufheben wollen; keine der Kommunalverwaltungen in Ecuador hat jedoch die Budgetzuweisungen erhalten, um die Schwierigkeiten zu bewältigen, die im Zusammenhang mit der Haushaltskrise auftreten werden.
- Die Produktionssektoren drängen sehr darauf, zur "Normalität" zurückzukehren, doch die "Rückkehr"-Pläne sind von jedem dieser Sektoren selbst erstellt worden.
- Diese 50 Tage der Restriktion im Land haben dazu geführt, dass: (i) mehr als 25% der Menschen im privaten Sektor ohne Arbeit sind, (ii) etwa 30.000 öffentliche Angestellte entlassen wurden, (iii) nach Angaben der Polizei die Kriminalität aufgrund mangelnder Beschäftigung zugenommen hat, (iv) sich das Konsumverhalten massiv verschlechtert hat.
*Übersetzung aus dem Spanischen von Leon Schepers
[1] In Guayaquil zum Beispiel gab es vor der Pandemie 1.200 Todesfälle pro Monat; in diesen Tagen wurden 10.000 Tote identifiziert.
[2] La Historia y Periodismo de Investigación | 02 May 2020 |Revista Digital.
[3] Dieser Inhalt wurde ursprünglich von der Zeitung EL COMERCIO unter folgender Adresse veröffentlicht: EL COMERCIO (LINK)
Gianina Guadalupe/ Tobias Kanschick (02.05.2020): Perú - Abwarten und Tee trinken | Perú - Espera y bebe té
Dieser Text ist in zwei Sprachen verfügbar:
Este texto está disponible en dos idiomas:
Español
Perú - espera y bebe té
Guadalupe Zavala y
Tobias Kanschick
02.05.2020
 |
Somos Tobias Kanschick, graduado de maestría en sociología en la Universidad de Hamburgo y profesor de métodos empíricos en la FOM Universidad de Economía y Administración y Gianina Elizabeth Guadalupe Zavala, cocinera de Perú. |
Si hay un informe sobre Perú en la crisis de la corona, es principalmente por una razón: muchos turistas tuvieron que permanecer en cuarentena durante mucho tiempo y fueron difíciles de abandonar, razón por la cual Perú fue incluso uno de los países prioritarios de la campaña de retorno de la Oficina Federal de Relaciones Exteriores. (Pequeña digresión: en general, fue sorprendente ver en la crisis de la corona cuántos ciudadanos alemanes viajan por el mundo al mismo tiempo. Habíamos escuchado el término "campeón mundial de viajes" antes, pero nos sorprendió que hubiera tantos).
Sin embargo, eso solamente fue una de las medidas porque en Perú se aplica una rigurosa política de cierre: a los hombres y mujeres solo se les permite salir en días alternos. La casa solo puede dejarse para trabajar o para ir al supermercado, a la farmacia y al banco. En principio, las compras solo pueden ser realizadas por una persona por hogar. Más de 2.000 policías ya han sido infectados con el virus, mientras que solo hay 632 camas de cuidados intensivos.
Nuestra familia en Lima ha tenido que quedarse en casa por más de un mes. Esto es particularmente importante porque Lima tiene una densidad de población extremadamente alta y el gobierno teme que el sistema de salud esté sobrecargado. Nuestra familia (padres de Gianina con su hermana y su hijo) vive en un edificio de apartamentos en varios pisos con varios tíos y tías, lo cual es difícil en la gran cohesión familiar. Además, solo la madre de Gianina va de compras porque su padre y su hermana están en riesgo. Los dos tienen problemas pulmonares ya que solían vivir en la ciudad andina La Oroya, donde el padre trabajaba como soldador. Por esta razón, tienen que quedarse en la casa. Se sienten encerados, especialmente porque el comienzo del año es el mejor momento climático en Lima. Asi la situación es particularmente difícil para nuestro sobrino Emanuel (6 años), quien en realidad está en la mitad de su primer año escolar. Ahora, sin embargo, está en casa y, como en Alemania, tiene que tomar lecciones virtuales sobre Zoom. Sin embargo, esto no siempre es tan fácil porque muchas personas usan Internet al mismo tiempo y esto lo ralentiza.
El primer año es importante pues es ahí donde se hacen amigos y acostumbran a la vida escolar cotidiana ahora este primer se ha ido para él. Pero la familia trata de hacerlo lo más cómodo posible. Hacen muñecas, cantan o miran sermones en Internet. Hubo recursos notablemente largos para este último, ya que las iglesias evangelicalas en Perú intenta deliberadamente presentarse de una manera moderna y, si no llena los estadios, ahora llega a los fieles a través de las redes sociales.
Ante esta situación, afortunadamente, nuestra familia ahorró algo de dinero y puede llegar a fin de mes en este momento económicamente difícil. La situación es diferente para muchas personas que trabajan en el sector informal o con jornaleros en la capital del Perú. Aquí hay una cierta solidaridad (por ejemplo, dan comida a los que no tienen en la calle) pero las medidas son igualmente difíciles de implementar.
Para prevenir y mantener el virus fuera del cuello aparte de quedarse en casa, se desinfecta a gran escala y el consumo de té y naranjas y todo lo que fortalece el sistema inmunológico es muy popular. De lo contrario, el lema es: mirar hacia adelante, confiar en Dios y matar el tiempo. Nosotros por supuesto, tratamos de mantenernos en contacto a través de videollamadas. Es una sensación extraña saber que hay pocas restricciones en Alemania, a pesar de que hay más de 100,000 casos. Es difícil estar para la familia desde lejos, especialmente porque tienes que superar las dificultades relacionadas con la corona y no puedes ayudar coo lo desearias. Pero hay que decir una cosa: en comparación con el país vecino Ecuador, el número de casos en El Perú se mantuvo relativamente bajo gracias a las rigurosas medidas tomadas por el gobierno.
Deutsch
Peru – Abwarten und Tee trinken
Guadalupe Zavala und
Tobias Kanschick
02.05.2020
 |
Wir sind Tobias Kanschick, Masterabsolvent der Soziologie an der Universität Hamburg und Dozent für empirische Methoden an der FOM Hochschule für Ökonomie und Management und Gianina Elizabeth Guadalupe Zavala, studierte Köchin aus Peru. |
Wenn über Peru in der Coronakrise berichtet wird, dann vor allem aus einem Grund: Viele Touristen mussten lange in Quarantäne und konnten nur schwer ausreisen, weshalb Peru sogar eins der priorisierten Länder der Rückholaktion des Auswärtigen Amts darstellte. (Kleiner Exkurs: Generell erstaunlich war es in der Coronakrise zu sehen, wie viele Deutsche Staatsbürger gleichzeitig weltweit unterwegs sind. Man hatte ja schonmal den Begriff „Reiseweltmeister“ gehört, aber dass es so viele sind, hat uns doch überrascht.)
Dies war aber nur eine von vielen Maßnahmen, denn in Peru wird eine rigorose Lockdownpolitik verfolgt: Männer und Frauen dürfen nur an abwechselnden Tagen rausgehen. Das Haus darf nur zur Arbeit oder für den Gang zu Supermarkt, Apotheke und Bank verlassen werden. Grundsätzlich dürfen Einkäufe nur von einer Person pro Haushalt getätigt werden. Bereits jetzt haben sich allein über 2000 Polizisten mit dem Virus infiziert, während es lediglich 632 Intensivbetten gibt.
Unsere Familie in Lima muss seit über einem Monat zu Hause bleiben. Das ist vor allem wichtig, da Lima eine extreme Bevölkerungsdichte aufweist und die Regierung eine Überlastung des Gesundheitssystems befürchtet. Dabei wohnt unsere Familie, (Eltern von Gianina mit ihrer Schwester und dessen Sohn) wie in Lima nicht unüblich, in einem Mehrfamilienhaus auf mehreren Etagen mit diversen weiteren Onkeln und Tanten zusammen, die sie aber aufgrund der Maßnahmen nicht besuchen können, was bei dem großen Familienzusammenhalt schwierig ist.
Hinzu kommt, dass nur Gianinas Mutter zum Einkaufen gehen, da ihr Vater und ihre Schwester zu den Risikogruppen gehören. Die beiden haben Lungenprobleme, da sie früher in der Andenstadt La Oroya gelebt haben, wo der Vater als Schweißer tätig war. Aus diesem Grund müssen sie im Haus bleiben. Da kann einem schon mal die Decke auf den Kopf fallen, zumal der Beginn des Jahres die klimatisch schönste Zeit in Lima ist.
Besonders schwierig ist die Situation für unseren Neffen Emanuel (6 Jahre), der sich eigentlich mitten in seinem ersten Schuljahr befindet. Nun ist er allerdings zu Hause und muss, ähnlich wie in Deutschland, virtuellen Unterricht über Zoom in Anspruch nehmen. Allerdings ist dies nicht immer so einfach, da viele Personen gleichzeitig das Internet in Anspruch nehmen und dieses dadurch verlangsamt wird.
Das wichtige erste Jahr in welchem man Freunde findet und sich an den Schulalltag gewöhnt, fällt nun weitestgehend für ihn weg. Die Familie versucht aber, es ihm so angenehm wie möglich zu machen. Sie basteln Puppen, singen oder schauen sich Predigten im Internet an. Für letzteres bestanden bereits bemerkenswert lange Ressourcen, da die evangelikalen Kirchen in Peru versuchen sich bewusst modern zu präsentieren und wenn sie nicht Stadien füllt, die Gläubigen über Social Media zu erreichen.
Zum Glück hat unsere Familie etwas Geld gespart und kann in dieser auch wirtschaftlich schwierigen Zeit über die Runden kommen. Anders die vielen Menschen, die in Perus Hauptstadt im informellen Sektor oder als Tagelöhner beschäftigt sind. Hier gibt es zwar eine gewisse Solidarität, was sich beispielsweise durch die Verteilung von Lebensmitteln zeigt, aber diese Maßnahmen sind aufgrund der weitest gehenden Ausgangssperre entsprechend schwierig umzusetzen.
Um sich das Virus vom Hals zu halten wird im großen Stile desinfiziert undauch der Verzehr von Tee und Orangen und allem, was die Abwehrkräfte stärkt, steht hoch im Kurs. Ansonsten heißt das Motto: Nach vorne schauen auf Gott vertrauen und die Zeit totschlagen.
Wir versuchen natürlich den Kontakt über Videollamadas (Videoanrufe) zu halten. Es ist schon ein etwas merkwürdiges Gefühl, wenn man weiß, dass man in Deutschland wenig mit Einschränkungen konfrontiert ist, obwohl es bereits wie über 100.000 Fälle in Deutschland gibt, während die Familie auf den Großausbruch wartet, der noch nicht da ist. Es ist schwierig, aus der Ferne für die Familien da zu sein, zumal man selbst Corona-bedingte Schwierigkeiten zu überstehen hat und nicht helfen kann. Eines muss man aber konstatieren: Im Vergleich zum Nachbarland Ecuador konnten die Fallzahlen durch die rigorosen Maßnahmen relativ gering gehalten werden.
Renata de Carvalho do Val (29.04.2020): Covid-19: Die Bekämpfung des Virus in einem ungleichen Land | Covid-19 o combate ao vírus em um país desigual
Dieser Text ist in zwei Sprachen verfügbar:
Este texto está disponível em duas línguas:
Português
Covid-19 o combate ao vírus em um país desigual
Renata de Carvalho do Val
29.04.2020
 |
Estudou ciências da comunicação no Brasil, na sua cidade natal, São Paulo. Na Alemanha, licenciou-se em Linguística e está agora a fazer um mestrado em Estudos Latino-Americanos na Universidade de Hamburgo (foco na juventude e movimentos sociais). Desde os seus tempos de escola que é uma activista ecologista e faz agora parte do colectivo Miradas Feministas em Hamburgo. |
No dia 11 de março de 2020, a OMS (Organização Mundial de Saúde) declarou o Corona vírus, causador da doença COVID-19, como uma pandemia, atingindo, principalmente, países do continente europeu e os Estados Unidos, regiões que há pelo menos 100 anos não viam uma doença se propagar com tanta velocidade deixando tantos mortos. As vítimas pertencem às diversas classes sociais e de todos os gêneros, o que tem classificado o vírus, até agora como uma “doença democrática”.
No Brasil, a pandemia nos faz lembrar episódios históricos do nosso país iniciados no século XVI, como a chegada dos europeus ao continente americano, o genocídio indígena e de povos sequestrados da África. A expansão de doenças não conhecidas na América, transmitidas pelos colonizadores, levou à morte de milhões de indígenas, além do sequestro, transporte sem higiene, do trabalho forçado e a falta de acesso ao saneamento básico que também ceifaram milhões de vidas negras. Estes acontecimentos do “passado” não estão muito distantes da atualidade.
Logo após o anúncio dos primeiros casos de Corona na Europa, já se falava do perigo deste vírus chegar ao Brasil, com o grande volume de turistas, principalmente europeus, que vinham pular carnaval e de muitos brasileirxs (com alto poder aquisitivo) que se utilizam dessa data do ano para viajar ao exterior. Apesar de por um lado, o vírus ter sido primeiramente apresentado como letal “apenas” para pessoas de uma certa faixa etária, e de ser divulgado que a higienização das mãos seria um método eficiente para combatê-lo, por um outro lado, lideranças indígenas já denunciavam a possibilidade dessa doença se tornar um segundo genocídio de seus povos e as lideranças negras e da periferia discutiam sobre a falta de leitos nos hospitais públicos, acesso à água potável e saneamento básico. Estas denúncias deixam claro que o vírus apesar de se propagar e infectar de forma “democrática”, ele atinge socialmente as pessoa de forma distinta. Afinal, como combater tal pandemia se nem os direitos e necessidades básicas de um povo são respeitados?
O que tem tornado a pandemia no Brasil ainda mais dramática é, de fato, o descaso e negligência que o governo federal brasileiro tem encarado esta doença. Embora houvesse uma discussão de como tal vírus poderia se tornar uma “tragédia no país e levar ao colapso o sistema saúde”, o presidente Jair Bolsonaro não desenvolveu nenhuma tática pra lidar com a pandemia, afirmando que o Covid-19 era perigoso “apenas” para idosos e que os seus sintomas era de uma “gripezinha”. Ademais o Presidente da República motivou a população a manter sua rotina, trocou o seu ministro da saúde em plena pandemia declarou que seu foco era a saúde econômica do Brasil que, não poderia ser afetada. Sem contar que Bolsonaro também manteve os cortes no orçamento do SUS (Sistema Único de Saúde), sistema este que tem passado por um pesado processo de sucateamento com cortes e congelamento em seu orçamento nos últimos quatro anos.
Com um sistema de saúde precário e um chefe de estado omisso, o Brasil já vinha sofrendo com um outro surto, o da Dengue, que só no início deste ano já havia contabilizado 350.000 casos, além de seguir com o desmatamento na floresta Amazônica, o que potencializa a expansão de doenças como a própria Dengue e a Febre Amarela. Foi dentro deste cenário mórbido que o corona se alastrou pelo país de forma rasante infectando[1], até agora, pelo menos 96.559 pessoas e levando a óbito 6.750[2], em todo o país.
Estudos realizados pelo Ministério da Saúde têm mostrado que o perfil das vítimas do coronavírus no Brasil tem rejuvenescido em comparação com a Europa. Enquanto, no continente europeu os/as pacientes mais graves estavam na faixa etária de 60 anos, no Brasil a idade média é de 30 anos. Um dos fatores que explicam isso é a qualidade de vida que as pessoas levam. Outro dado interessante que foi levantado pelo ministério, é que apesar dos números de pessoas brancas infectadas ser maior que o número de pessoas negras, a letalidade do vírus é muito maior entre os negrxs. O que poderia explicar este dado é o fato de a desigualdade social no país estar ancorada em um racismo estrutural. Também é importante ressaltar que 67% dos brasileirxs que dependem integralmente do SUS são negrxs.
A favela não tem direito a distanciamento social.
A desigualdade no Brasil tem cor e as mortes por corona também. Cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza e Manaus já começaram a mandar pacientes para casa por não terem leitos disponíveis em hospitais. Não é de se espantar que estes hospitais estejam localizados, conforme Carolina Maria de Jesus afirma, nos bairros do “Quarto de despejo”, os bairros da periferia. Sem a possibilidade de um acompanhamento médico a probabilidade de morte do paciente também aumenta.
Comunidades e bairros periféricos em todo o Brasil tem se auto-organizado para amenizar os estragos que o vírus vem deixando nessas regiões. Tendo grande parte de sua população formada por trabalhadorxs informais, casas de tamanhos minúsculos que servem de teto para mais de uma família e a falta de saneamento básico, “o lavar as mãos se torna um privilégio”, o álcool em gel um artigo de luxo e o distanciamento social apenas palavras sem fundo semântico. Nestes locais o real medo é o da fome; esta ainda é a maior preocupação. Enquanto nos bairros de elite se discute sobre “Home Office” e quais esportes praticar nas horas ociosas, a periferia continua pegando ônibus lotado para chegar nesses bairros abastados, onde irão cozinhar em restaurantes, fazer entregas, ou seguir nos afazeres domésticos nas casas de alguém que “não sabe nem lavar um prato”.
Com um presidente disponibilizando recursos para salvar empresas, o Congresso e o Senado brasileiro assinaram uma emenda que disponibiliza o valor de 600 reais às famílias carentes. Tal ajuda deveria auxiliar àqueles que atualmente não podem trabalhar devido as medidas de saúde adotadas em algumas regiões. Depois de segurar a medida por mais de 2 semanas, o governo federal liberou a verba, mas de forma tão burocrática que se torna quase impossível o acesso ao dinheiro. Como por exemplo, obrigando as pessoas a se cadastrarem em portais da internet (uma vez que as pessoas que necessitam destas verbas não têm acesso a tal recurso) e a regularizarem documentos, em um período em que a cidade está parada.
Corona e violência nas periferias
A quarenta tem se mostrado um dos maiores inimigos das mulheres e dos/das jovens, nas cidades que tem aderido ao isolamento social, expondo estxs a violência. Com o agravamento de problemas financeiros e o aumento do consumo de álcool, a violência doméstica no Brasil tem aumentado. Só na cidade de São Paulo o número de feminicídios dobrou em comparação com o ano anterior. Essas mulheres que já sofrem com a violência doméstica se veem ainda mais desprotegidas: com o isolamento muitas redes de apoio se enfraquecem, dificultando, assim, a possibilidade de fuga e sua proteção.
Outro fator que tem colocado a vida da população periférica em risco é a presença da polícia militar nestas regiões. Uma vez que os meios de comunicação e demais instituições estão voltados para a pandemia, policiais militares se sentem à vontade para agredir ainda mais essa população. Relatos de jovens da periferia da região sul de São Paulo ilustram como os policiais se usam do isolamento social para atuar de forma ainda mais agressiva em seus bairros. A pesquisadora e militante Dina Alves afirma que tanto o vírus, quanto a polícia têm se tornado instrumentos para o plano necropolítico que o estado brasileiro tem aplicado.
“Se, de um lado, o governo se utiliza da força bélica para promover a sua política de isolamento e distanciamento social, causando ainda mais terror na periferia, é esta mesma população vítima histórica da violência policial que sente o aprofundamento destas violências: além de ser exposta ao vírus letal pelo estado, ela também morre pelas mãos da polícia” (Alves em Diogo & Borges 2020)
Fique em casa!
E quando uma das principais medidas de prevenção e controle do Covid-19 se torna impossível? A prefeitura de São Paulo afirma que hoje pelo menos 30 mil pessoas estão em situação de rua na cidade; a Pastoral do Povo da Rua afirma que este número é muito maior. Sem um teto as pessoas ficam na plena vulnerabilidade de contágio do corona. Sem água para lavar as mãos, higienização básica, só é possível o acesso a este recurso em dias de chuva, tornando qualquer medida de proteção ao vírus impossível. Muitxs vivem do trabalho de reciclagem (Carroceirxs) e dependem da distribuição de alimentos para poderem sobreviver. Com os comércios fechados e o isolamento social ambas possibilidades desaparecem deixando as pessoas em situação de rua abandonadas a própria sorte. Além da precariedade cotidiana na vida dessas pessoas, a violência polícia também tem se tornado presente. Com o projeto de “higienização” no centro de São Paulo que começou a ser implantado pelo então prefeito, João Doria, no qual se baseia no desmonte de programas de assistência social e albergues que apoiam as pessoas em situação de rua, a escalação brutal da violência na abordagem policial tem se tornado diária.
Dessa forma, as pessoas em situação de rua têm sido obrigadas a migrar do centro para as periferias da cidade. O perigo dessa migração é o abandono do poder público nestas regiões e o apagamento destas pessoas nas cidades. Distantes do centro, a locomoção, a possibilidade de acesso à assistências e o desenvolvimento de trabalho com reciclagem já não existem. Um exemplo disso é o fato de a prefeitura ter montado pias e pontos de assistência na região central da cidade, mas ter excluídos tal medidas das áreas periféricas de São Paulo, locais onde se concentra o maior número de pessoas carentes.
Por fim, temos consciência que ainda é cedo para dizer qual herança essa pandemia deixará para o nosso país, mas já podemos afirmar que o coronavírus expos de forma clara que a desigualdade social, o racismo e a misoginia (ou em outras palavras o capitalismo e o patriarcado) são muito mais mortais que a pandemia.
[1] É importante ressaltar, que o Brasil é o país menos efetuar testes do corona, isso significa que estes números poderiam triplicar se a margem de pessoas testadas também aumentasse.
[2] Atualizado no dia 02.03.2020 pelo Ministério da Saúde.
Deutsch
Covid-19: Die Bekämpfung des Virus in einem ungleichen Land
Renata de Carvalho do Val
29.04.2020
 |
Sie studierte Kommunikationswissenschaften in Brasilien, in ihrer Heimatstadt São Paulo. In Deutschland schloss sie das Studium der Sprachwissenschaft ab und macht jetzt den Master in Lateinamerika-Studien an der Universität Hamburg (Fokus Jugendliche und Soziale Bewegungen). Seit ihrer Schulzeit ist sie Umweltaktivistin und heute Teil des Kollektivs Miradas Feministas in Hamburg. |
Am 11. März erklärte die WHO (Weltgesundheitsorganisation) das Corona-Virus, COVID-19, zu einer Pandemie. Sie betrifft die vor allem Länder des europäischen Kontinents und die Vereinigten Staaten betrifft, Regionen, in denen sich seit mindestens 100 Jahren keine Krankheit so schnell ausgebreitet hat und so viele Tote gefordert hat. Die Opfer gehören verschiedenen sozialen Schichten und allen Altersgruppen an, was das Virus bisher als "Demokratiekrankheit" klassifizieren lässt.
In Brasilien erinnert uns die Pandemie an historische Episoden unseres Landes, die im 16. Jahrhundert begannen, wie die Ankunft der Europäer auf dem amerikanischen Kontinent, der Völkermord an den bisherigen Bewohnern und die aus Afrika verschleppte Bevölkerung. Die Ausbreitung von in Amerika unbekannten Krankheiten, die von den „Kolonisatoren“ übertragen wurden, führte zum Tod von Millionen von Menschen. Dazu kamen die Entführungen, menschenunwürdige Transportbedingungen, Versklavung und der fehlende Zugang zu grundlegenden sanitären Einrichtungen, was auch Millionen von schwarzen Menschen das Leben kostete. Diese "vergangenen" Ereignisse sind nicht weit von heute entfernt.
Unmittelbar nach der Bekanntgabe der ersten Fälle von Corona in Europa wurde bereits von der Gefahr gesprochen, dass dieser Virus Brasilien erreichen könnte, da viele Touristen, hauptsächlich EuropäerInnen, kamen, um den Karneval zu feiern, und viele Brasilianer (mit hoher Kaufkraft - Obere und Mitteschicht), diese Jahreszeit nutzen, um ins Ausland zu reisen. Obwohl einerseits das Virus zunächst "nur" für Menschen einer bestimmten Altersgruppe als tödlich dargestellt und verbreitet wurde, dass das Händewaschen eine wirksame Methode zur Bekämpfung des Virus sei, prangerten andererseits die indigenen FührerInnen bereits die Möglichkeit an, dass diese Krankheit zu einem zweiten Völkermord an ihrer Bevölkerung führen könnte, und die Repräsentanten der Afro-Brasilianer*innen und der in der Peripherie lebenden Menschendiskutierten den Mangel an Krankbetten in öffentlichen Krankenhäusern, den Zugang zu Trinkwasser und grundlegenden sanitären Einrichtungen in ihren Stadtteilen. Diese Anklagen machen deutlich, dass das Virus, obwohl es sich auf "demokratische" Weise verbreitet und infiziert, die Menschen sozial unterschiedlich trifft.
Denn wie kann eine solche Pandemie bekämpft werden, wenn die grundlegenden Rechte und Bedürfnisse eines Volkes nicht respektiert werden?
Was die Pandemie in Brasilien noch dramatischer gemacht hat, ist in der Tat die Vernachlässigung, mit der die brasilianische Bundesregierung dieser Krankheit begegnet ist. Obwohl es bereits früh eine Diskussion darüber gab, wie ein solches Virus zu einer "Tragödie im Land werden und zum Zusammenbruch des Gesundheitssystems" führen könnte, entwickelte Präsident Jair Bolsonaro keine Taktik im Umgang mit der Pandemie, abgesehen von der Feststellung, dass der Covid-19 "nur" für ältere Menschen gefährlich sei, dass die Symptome die einer "kleinen Grippe" seien, motivierte der Präsident die Bevölkerung auch, ihre Routine beizubehalten, entließ seinen Gesundheitsminister und erklärte, dass sein Schwerpunkt auf der wirtschaftlichen Gesundheit Brasiliens liege. Ganz zu schweigen davon, dass der Präsident auch an den Budgetkürzungen des SUS (Generalisiertes Gesundheitssystem) festhielt, eines Systems, das in den letzten vier Jahren einen schweren Prozess des Abwrackens mit Kürzungen und Einfrieren des Budgets durchlaufen hat.
Mit einem prekären Gesundheitssystem und einem ausweichenden Repräsentanten des Staates, litt Brasilien bereits an einem weiteren Krankheitsausbruch, dem des Dengue-Fiebers, der Anfang dieses Jahres allein bereits 350.000 Fälle ausmachte. Dieser Effekt könnte durch die zusätzlich anhaltende Abholzung in Rekordhöhe im Amazonas-Regenwald verstärkt werden, da die Ausbreitung von Krankheiten wie Denguefieber und Gelbfieber sich hierdurch potenziert. Im Rahmen dieses morbiden Szenarios breitete sich Corona rasend schnell über das Land aus, infizierte[1] bisher mindestens 96.559 Menschen und führte zum Tod von 6.750[2] Menschen im ganzen Land.
Vom Gesundheitsministerium durchgeführte Studien haben gezeigt, dass sich das Profil der Coronavirus-Opfer in Brasilien im Vergleich zu Europa verjüngt hat. Während in Europa die am schwersten betroffenen Patienten um die 60 Jahre alt waren, liegt das Durchschnittsalter in Brasilien bei 30 Jahren. Einer der Faktoren, die dies erklären, ist die Lebensqualität, die diese Menschen haben. Eine weiteres interessante Tatsache, die vom Ministerium bekannt gegeben wurde, ist, dass, obwohl die Zahl der infizierten Weißen höher ist als die Zahl der Schwarzen, die Letalität des Virus unter den Schwarzen viel höher ist. Was diese Daten erklären könnte, ist die Tatsache, dass die soziale Ungleichheit im Land im strukturellen Rassismus verankert ist. Es ist auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass 67% der BrasilianerInnen, die vollständig vom SUS abhängig sind, Schwarze sind.
Die Favela hat kein Recht auf soziale Distanzierung.
Die Ungleichheit in Brasilien hat „Farbe“, ebenso wie die Corona-Todesfälle. Städte wie São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza und Manaus haben bereits damit begonnen, Patienten nach Hause zu schicken, weil in den Krankenhäusern keine Betten mehr zur Verfügung stehen. Es ist nicht überraschend, dass sich diese Krankenhäuser, wie Carolina Maria de Jesus sagt, in den Vierteln mit "unerwünschten Menschen[3]" befinden, da sich die Todeswahrscheinlichkeit des/ der Patientin ohne Behandlung im Krankhaus erhöht.
Gemeinschaften[4] und periphere Stadtviertel in ganz Brasilien haben sich selbst organisiert, um die Schäden zu mindern, die das Virus in diesen Regionen hinterlassen wird. Da sich ein großer Teil der Bevölkerung aus informellen Arbeiter*innen zusammensetzt, sie in winzigen Häusern leben, die mehr als einer Familie als Dach dienen, und es keine grundlegenden sanitären Einrichtungen gibt, wird Händewaschen zum Privileg, Desinfektionsgel ein Luxusartikel und die Rede von sozial Distanzierung lediglich zu Worten ohne semantischen Gehalt. An diesen Orten ist die wahre Angst der Hunger, dies ist immer noch die größte Sorge. Während in den elitären Vierteln über das "Home Office" und darüber diskutiert wird, welche Sportarten während der Leerlaufzeiten ausgeübt werden sollen, fährt die Peripherie weiterhin in überfüllten Bussen zu diesen wohlhabenden Vierteln, wo sie in Restaurants kochen, Auslieferungen vornehmen oder die häusliche Arbeit in den Häusern von jemandem verrichten, der "nicht einmal weiß, wie Geschirr gespült wird".
Mit einem Präsidenten, der vorrangig Mittel zur Rettung von Unternehmen bereitstellt, unterzeichneten der Kongress und der brasilianische Senat ein Gesetz, das die Summe von 600 Reais für bedürftige Familien zur Verfügung stellt. Diese Mittel sollen denen helfen, die aufgrund der in einigen Regionen verabschiedeten Gesundheitsschutzmaßnahmen derzeit nicht arbeiten können. Nachdem die Maßnahme mehr als 2 Wochen zurückgehalten wurde, gab die Bundesregierung das Geld frei, aber auf so bürokratische Weise, dass es fast unmöglich ist, an das Geld heranzukommen. Zum Beispiel indem Menschen gezwungen werden, sich auf Internetportalen zu registrieren, obwohl die Menschen, die diese Mittel benötigen, keinen Zugang zu solchen Ressourcen haben, und Dokumente zu regularisieren, zu einer Zeit, in der die Stadt stillsteht.
Corona und Gewalt in den Peripherien
Die Quarantäne erweist sich als einer der größten Feinde der Frauen und Jugendlichen in den Städten, die an der sozialen Isolation festhalten und sie der Gewalt aussetzen. Mit der Verschärfung finanzieller Probleme und dem Anstieg des Alkoholkonsums hat die häusliche Gewalt in Brasilien zugenommen. Allein in der Stadt São Paulo hat sich die Zahl der Frauenmorde im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt. Diese Frauen, die bereits unter häuslicher Gewalt leiden, finden sich durch die Isolation, in der viele Unterstützungsnetzwerke eingeschränkt sind, noch schutzloser wieder, was es schwierig macht, der Gewalt zu entkommen und die Frauen zu schützen.
Ein weiterer Aspekt, der das Leben der Bevölkerung in der Peripherie gefährdet, ist die Präsenz der Militärpolizei in diesen Regionen. Da sich die Medien und andere Institutionen auf die Pandemie konzentrieren, steht es der Militärpolizei frei, die Bevölkerung weiter anzugreifen. Berichte von Jugendlichen aus der Peripherie der südlichen Region von São Paulo veranschaulichen, wie Polizisten die soziale Isolation nutzen, um in ihren Vierteln noch aggressiver zu agieren. Die Forscherin und Aktivistin Dina Alves sagt, dass sowohl das Virus als auch die Polizei zu Instrumenten für den nekropolitischen Plan geworden sind, den der brasilianische Staat anwendet.
"Wenn einerseits die Regierung kriegerische Gewalt anwendet, um ihre Politik der Isolation und der sozialen Distanzierung zu fördern, und damit noch mehr Terror in der Peripherie verursacht, ist es dieselbe Bevölkerung, als historisches Opfer der Polizeigewalt, die das Anwachsen dieser Gewalt spürt: Sie wird nicht nur vom Staat dem tödlichen Virus ausgesetzt, sondern stirbt auch durch die Hand der Polizei" (Alves in Diogo & Borges 2020)
Bleib zu Hause!
Und wenn eine der wichtigsten Maßnahmen zur Prävention und Kontrolle von Covid-19 unmöglich wird? Das Rathaus von São Paulo gibt an, dass aktuell mindestens 30.000Menschen in der Stadt auf der Straße leben, die Pastoral do Povo da Rua (Patorale des Volks auf der Straße) gibt an, dass diese Zahl viel höher liegt. Ohne eine Bleibe sind die Menschen dem vollen Risiko einer Ansteckung durch Corona ausgesetzt. Ohne Wasser zum Händewaschen, ohne eine sanitäre Grundversorgung, die nur an Regentagen möglich ist, wird jede Maßnahme zum Schutz vor dem Virus für diese Menschen unmöglich. Vielen leben von der Arbeit des Recyclings (als „Altpapier- und Schrottsammler*innen“) und sind auf die Verteilung von Nahrungsmitteln angewiesen, um zu überleben. Mit geschlossenen Geschäften und sozialer Distanzierung verschwinden beide Möglichkeiten und die Menschen auf der Straße bleiben ihrem Schicksal überlassen. Neben der täglichen Prekarität im Leben dieser Menschen ist auch die Polizeigewalt präsent geworden. Mit dem Projekt der "Hygienisierung" im Zentrum von São Paulo, dass der damalige Bürgermeister João Doria (2016) in Angriff nahm und das auf dem Abbau von Sozialhilfeprogrammen und Wohnheimen basierte, die Menschen in „situação de rua“ (Obdachlose) unterstützten, ist die brutale Eskalation der Gewalt im Vorgehen der Polizei alltäglich geworden. So waren Menschen in Straßensituationen gezwungen, vom Zentrum in die Peripherien der Stadt abzuwandern. Die Gefahr dieser Migration ergibt sich aus dem Rückzug staatlicher Präsenz in diesen Regionen und dem Verschwinden dieser Menschen aus den Städten. Abseits des Zentrums sind die Möglichkeiten zur Fortbewegung, des Zugangs zu Hilfeleistungen und die Ausübung der Arbeit im Recyclingbereich nicht mehr gegeben. Ein Beispiel dafür ist die Tatsache, dass frühere Stadtverwaltungen im zentralen Teil der Stadt Waschbecken und Hilfsposten eingerichtet hatten, solche Maßnahmen aber für die Randgebieten der Stadt ausgeschlossen hat, wo sich die meisten bedürftigen Menschen konzentrieren.
Abschließend sind wir uns dessen bewusst, dass es noch zu früh ist, um zu sagen, welches Erbe diese Pandemie in unserem Land hinterlassen wird, aber wir können bereits jetzt feststellen, dass das Coronavirus soziale Ungleichheit, Rassismus und Frauenfeindlichkeit (oder mit anderen Worten: Kapitalismus und Patriarchat) als eindeutig viel tödlicher als die Pandemie selbst entlarvt.
[1] Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass Brasilien das Land mit den wenigsten Corona-Tests ist, was bedeutet, dass sich diese Zahlen verdreifachen könnten, wenn die Zahl der getesteten Personen ebenfalls zunähme.
[2] Aktualisiert auf der Website des brasilianischen Gesundheitsministeriums am 02.03.2020.
[3] Carolina Maria de Jesus in ihrem Werk – Tagebuch der Armut – redet sie über wie die Favelas in Brasilien als Abstellkammern von armen Menschen funktionieren. Sie erwähnt, dass der Staat die Menschen in Favelas nicht wahrnimmt und häufig als Störung behandeln.
[4] Meiner Meinung nach kann das Wort Gemeinschaft als Synonym für Favela angesehen werden. Der Unterschied besteht darin, dass der Begriff Gemeinschaft ein Gefühl der Zugehörigkeit, des Respekts und der Solidarität an einem Ort ausdrückt. Das Wort Favela wurde hauptsächlich in den Medien verwendet, um diese Viertel in einem sozialen und städtischen Kontext zu entmenschlichen und weiterhin zu marginalisieren.
Nayeli Ávila Gutiérrez (25.04.2020): La crisis de los cuidados en tiempos de coronavirus
La crisis de los cuidados en tiempos de coronavirus
Nayeli Ávila Gutiérrez
25.04.2020
 |
Nayeli Ávila Gutiérrez es una estudiante española de origen peruano. Egresada en Literatura alemana e italiana por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente realiza el máster de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Hamburgo. |
Hace mes y medio volví a Hamburgo. Soy, al igual que varios jóvenes de mi generación, una persona marcada por la migración. Mis padres se mudaron de Perú a España cuando yo tenía cinco años, ahí he crecido y me he formado académicamente, a excepción de un tiempo que estudié en Italia y desde hace cuatro años, cuando me trasladé a Alemania.
Desde que tengo recuerdo, mis padres han participado en colectivos migrantes en Madrid y me han enseñado la importancia y la necesidad de considerar a las personas por lo que son y por lo que aportan, apreciando sus diferencias y exigiendo los mismos derechos para todos, independientemente de nuestro lugar de origen. Tengo esta lucha muy interiorizada, no solo por el diálogo con mis familiares, sino porque, a pesar de sentirme bastante integrada en el continente europeo, mis rasgos me delatan respecto a mi país de procedencia y sé que seguirán marcando esa diferencia con el resto de mis compañeros. Es por ello que, al reflexionar sobre la situación actual, no puedo dejar de pensar en el colectivo migrante en España, que poco a poco está consiguiendo un espacio de reconocimiento social y político, pero todavía queda un largo camino por delante.
Al día de hoy, España es considerado el segundo país con más personas infectadas por el covid-19, y el tercero en número de fallecidos. El confinamiento ya va por su sexta semana y a partir de la próxima se empezará a suspender de manera leve y gradual. Sin embargo, durante todo este tiempo son varios los trabajos que, al considerarse esenciales, no han cesado en ningún momento. Con esta referencia es inevitable pensar directamente en los profesionales sanitarios, los trabajadores de la limpieza y los trabajos de cuidados. Ellos y ellas atienden a nuestros mayores, quienes a pesar de recibir una atención constante, son los más afectados por esta pandemia; y de hecho es larga la lista de trabajos que hasta hace unas semanas no habíamos sido conscientes de su gran importancia. Resulta casi imposible imaginarse el confinamiento sin los negocios que nos provisionaran diariamente de alimentos.
De igual manera, es necesario tener en cuenta una serie de datos: de los casi cuarenta y siete millones de habitantes del territorio español, más de cinco millones y medio son extranjeros, cifra que no contabiliza a los más de dos millones de nacionalizados ni a los alrededor de seiscientos mil inmigrantes irregulares, pero se podría decir que más del quince por ciento de habitantes en España proceden de otro país. De esta cifra, alrededor de cuatro millones proceden de Latinoamérica, y de ellos, del millón y medio trabajan de manera legal. Estas personas se ocupan, principalmente, de los trabajos pertenecientes al sector de servicios, que hace referencia tanto a los trabajos en hostelería, como a los de limpieza o del servicio doméstico. Pese a que estos datos y la cantidad de familias latinoamericanas que sé de primera mano que están (mal-)viviendo esta crisis humanitaria, siento una gran preocupación por la situación laboral de las empleadas del hogar, que se rige entre la ilegalidad y la falta de reconocimiento social.
Algunos ciudadanos de países latinoamericanos tienen el ingreso libre al estado español, así como a otros 27 países de la UE, pudiendo permanecer en estos durante una corta estancia. Aquellas personas que, sin embargo, deciden trasladarse permanentemente a España y no cuentan con un contrato de trabajo o algún familiar que ya resida en él, permanecen en el país de manera irregular. Es por ello, que no es extraño que entre las personas migrantes siempre haya un conocido o conocida que, mientras regulariza sus papeles o convalida sus estudios, se incorpore en el mercado laboral o bien cuidando a otras personas o limpiando casas, como ha sido el caso de algunas de las mujeres de mi familia al llegar a España. La polémica tras estas situaciones no se centra únicamente en los obstáculos para incorporarse en un país extranjero, sino en la baja estima del sector al que acceden,
Al igual que otros colectivos migrantes, las empleadas del hogar en España, llevan años exigiendo al gobierno que se regularice su situación laboral, pues los contratos privados que firman, no respetan ni garantizan los derechos sociales básicos de las trabajadoras. Muchas de ellas se enfrentan a jornadas laborales que sobrepasan el máximo de horas establecido por el Estatuto y con salarios realmente bajos. Por si esto no fuera suficiente, un gran porcentaje de las empleadas del hogar viven exentas de protección legal, ya que no cotizan a la seguridad social y, por ende, no gozan de prestaciones públicas de desempleo. Esta situación se agrava para aquellas que, al no poder regularizar sus papeles, realizan este trabajo sin contrato alguno de por medio.
Por otra parte, varias de estas trabajadoras están siendo despedidas sin tener derecho a paro, a otras se les está obligando a permanecer en la casa de sus empleadores sin poder salir y muchas se ven sometidas a jornadas muy pesadas, que incluyen el cuidado de los niños mientras sus padres teletrabajan. Asimismo, en el trabajo de cuidados no se puede mantener una distancia de seguridad entre el trabajador y la persona a la que se cuida, pero tampoco se están estableciendo protocolos para que estas mujeres puedan protegerse del virus. A todo esto, hay que añadir los casos particulares de varias empleadas del hogar que, pese al temor a ser despedidas, buscan apoyo legal en la asociación del Servicio Doméstico Activo (SEDOAC) para sobrellevar lo mejor posible esta cuarentena.
La insuficiencia de leyes que amparen el trabajo de estas mujeres, no solamente pone en juego sus vidas, sino también la de los familiares dependientes, ya sea en España o en sus países de procedencia. Un Estado que realmente se preocupara por todos sus trabajadores no debería hacerles elegir entre recibir un sueldo o cuidar de los suyos, por lo que es imperativo exigir que las prestaciones decretadas en el régimen general de España, también sean aplicadas a las empleadas del hogar. Sobra decir que el problema no solo se encuentra en la falta de consideración de estos trabajos por la función que desempeñan, si no en los constantes recortes y en la falta de reconocimiento social a las personas que procedemos del extranjero… pero la batalla sigue en pie.
A pesar de que el coronavirus junto a la Ley actual de Extranjería limitan y precarizan bastante la situación preexistente, en España las trabajadoras del hogar han conseguido que se les otorgue el subsidio por desempleo para aquellas afectadas por el virus. Esta medida, no obstante, es insuficiente, por lo que es necesario seguir reivindicando la regularización de estas trabajadoras y de todos aquellos trabajadores extranjeros que no se vean amparados por la ley. Y es que como mujer migrante y en plena formación, a pesar de sentir una total preocupación por la situación económica a posteriori, me inquietan más las condiciones en las que varias familias- muchas de ellas migrantes y de bajos recursos- están viviendo actualmente.
No quisiera terminar sin recordar que también hay otros empleos, que, a raíz de la situación actual, continúan realizando sus labores en un estado de precarización total, como el caso de los trabajadores de envío a domicilio. Así que intentemos no dejarnos vencer por el desánimo o la ansiedad y seamos conscientes de la situación global actual quedándonos en casa, manteniendo el distanciamiento social aconsejado en nuestras salidas y teniendo presente el trabajo que realizan aquellas personas que se juegan la vida diariamente para que nosotros nos mantengamos a salvo.
Hannah Lahusen (23.04.2020): Der Coronavirus in Chile: Ausdruck gesellschaftlicher Ungleichheiten
Der Coronavirus in Chile: Ausdruck gesellschaftlicher Ungleichheiten
Hannah Lahusen
23.04.2020
 |
Hannah Lahusen ist Studentin der Kunstgeschichte an der Universität Hamburg. Zwischen Juli und März lebte sie in Santiago und studierte an der Universidad de Chile. Vor Ort erlebte sie hautnah die politischen Aufstände und den Ausbruch des Coronavirus. |
Mitte März war noch nicht der Virus die wahre Bedrohung vieler Chilen*innen, sondern die Regierung, gegen die bereits seit dem 18. Oktober 2019 demonstriert wurde. Nachdem die Semester- und Schulferien von Dezember bis Februar zu einer temporären Beruhigung der Proteste geführt hatten, war der sogenannte „Súper Marzo“ in aller Munde. Die Demonstrationen sollten noch stärker und besser organisiert zurückkehren. Diese Vorhersage erfüllte sich in den feministischen Demonstrationen vom 8. und 9. März. Bei diesen Protesten kam es schon zu einigen Anspielungen auf das Coronavirus. Folgende Parolen fand ich auf den Hauswänden Santiagos: „Tengo más miedo de mi pensión que del Coronavirus“, „El Coronavirus no es tan letal como el estado $hileno“, „Piñera—Virus“ und „Paco—Virus“.
Die unerwartet schnelle Ausbreitung des Coronavirus machte den Chilen*innen jedoch einen Strich durch die Rechnung. Im Zuge der steigenden Zahl der Infizierten sah ich in den Social Media vermehrt die Forderung „Quédate en casa“. Im Falle Chiles war es somit nicht die Regierung, welche die Krise von Anfang an ernst nahm, direkt handelte und Maßnahmen zur Eindämmung ergriff. Es waren diejenigen, die bis zu diesem Zeitpunkt auf den Straßen gegen die gesellschaftlichen Ungleichheiten in Chile kämpften. Sie blieben Zuhause, aber nicht aus dem Grund, weil sie aufgegeben hatten: Angesichts der Vernachlässigung durch den Staat beschützte sich nun das Volk untereinander. So wurde zum Beispiel der Beschluss, die Einkaufshäuser zu schließen, erst gefasst, als ein großer Teil der Chilen*innen, vor allem in Santiago, schon seit fast 3 Wochen Zuhause geblieben war.
Die freiwillige Quarantäne sehe ich somit als eine Fortführung des Protests gegen die momentane Regierung. Es wird von „Cuarantena Total Con Dignidad“ gesprochen. Besonders „Dignidad“ war bei den Protesten eine der Hauptforderungen. So wurde die Hauptdemonstrationsstätte in Santiago (ehem. „Plaza Italia“) von den Demonstrierenden in „Plaza de la Dignidad“ umbenannt.
Ich beobachtete, dass sich besonders während der Demonstrationen zahlreiche „asambleas“ in den verschiedenen Vierteln Santiagos und Valparaísos bildeten. In diesen fanden sich Nachbar*innen zusammen, um Essen zu teilen, Hilfeleistungen und Workshops anzubieten, Gemeinschaftsgärten anzulegen und vor allem, um über die aktuelle Lage und die Zukunft der Politik des Landes zu diskutieren. Diese Aktionen zeigen gerade in Zeiten von Corona ihre Wirkung: Es kommt zu zahlreichen Aufrufen der Solidarität unter Nachbar*innen. Zudem wird die politische Arbeit in Form von virtuellen Protesten in den sozialen Medien weitergeführt, und die „asambleas“ organisieren sich weiterhin über Videokonferenzen und Chats.
Bei der freiwilligen Quarantäne handelt es sich somit um einen Akt der Solidarität für die ältere Generation, für Menschen mit Immunschwäche, darüber hinaus aber auch für von der Regierung Vernachlässigte und von der Gesellschaft Ausgestoßene. Denn ein Virus stellt wegen der in einem Land vorherrschenden sozialen Ungleichheiten nicht eine auf die Bevölkerung gleichmäßig verteilte Bedrohung dar, die vor keinem Geschlecht, Einkommen, keiner Hautfarbe usw. halt macht. Benachteiligte, Diskriminierte und Familien in Armut haben auf Grund ihres Geldmangels oftmals nicht die Möglichkeit zum Arzt zu gehen. Vorerkrankungen häufen sich, es fehlt an grundlegenden Medikamenten, ärztlicher Versorgung und Schutzmöglichkeiten.
Auch in der Verbreitung des Virus lässt sich eine klare Unterscheidung nach Klassen vornehmen. So soll es bei den ersten dreißig Fällen um wohlhabende Menschen gegangen sein, die das Virus aus dem Ausland mitgebracht haben. Unter ihnen befanden sich auch einige Ärzt*innen, die trotz Symptomen weiterhin Patient*innen behandelten. Viele von ihnen wohnen in den Reichenvierteln Santiagos, so wie Vitacura, Las Condes und Lo Barnechea. Da sich die Zahlen der Infizierten besonders in diesen Gebieten immer weiter erhöhten, wurde am 26. März in Vitacura, Las Condes, Providencia, Santiago, Lo Barnechea und Ñuñoa die totale Quarantäne ausgerufen.
Bevor diese jedoch eingeführt wurde, fuhren Tausende wohlhabende „Santeguinos/as“ in ihre Ferienhäuser an der Küste. Darauf reagierten Einheimische mit Straßenbarrikaden, um die Verbreitung des Virus zu verhindern. Dessen ungeachtet traten ab diesem Zeitpunkt viele Fälle von Coronavirus auch in diesen Strand- und Ferienorten auf. Zudem ließen sich in den Nachrichten immer wieder scheinbar unmögliche Geschichten finden: wie z.B. die eines Mannes aus Santiago, der während der Quarantäne mit seinem Sportflugzeug nach Pichilemu flog, um dort Meeresfrüchte zu kaufen; oder die eines Bewohners von Las Condes, der während der Ausgangssperre auf einem öffentlichen Platz Golf spielte.
Während eine Vielzahl der Bewohner*innen der oben genannten Viertel in ihren Wohnungen, Häusern und Villen die Quarantäne einhielten (oder nicht einhielten), waren die unteren Bevölkerungsschichten nach wie vor der Gefahr einer Ansteckung ausgesetzt. Die Kluft zwischen dem sogenanntem „cuico“ („Schnösel“) und „pobre“ zeigt sich ganz klar: „El cuico pide riesgo, y el riesgo lo pone el pobre. El cuico pide fiesta, y para su goce expone al pobre. El cuico tiene hambre, y el alimento lo vende la pobre. El cuico tiene miedo, y mientras vuela abandona al pobre“, heißt es im „El desconcierto“, einem unabhängigen Online-Nachrichtenportal. Denn wer bei dieser angeblichen „Krankheit der Reichen“ verliert bzw. noch verlieren wird, ist vermutlich die ärmere Bevölkerung. Arbeitsrecht, Gesundheitssystem und die Quarantäne stehen leider nicht auf ihrer Seite.
So erließ die Dirección del Trabajo (DT) am 26. März eine Verordnung, mit der die Arbeitgeber*innen von der Zahlung der Löhne ihrer Arbeitnehmer*innen befreit werden, falls diese aufgrund des gesundheitlichen Notstands in Chile ihre Arbeitspflichten nicht erfüllen können. Hinzu kommt, dass vor allem Arbeitende der unteren Schicht oftmals nicht die Möglichkeit haben, in Form von Homeoffice weiterzuarbeiten; des weiteren verfügen sie meist erst gar nicht über die nötige technische Ausstattung (Computer, W-Lan, Smartphone …). Zusätzlich stellt sich die Frage nach der Unterbringung der Kinder und deren Versorgung mit notwendigem Lehrmaterial. Der öffentliche Transport funktioniert normal weiter und die Metro in Santiago transportiert nach wie vor jeden Tag Millionen von Menschen. Wer die Metro auch in Zeiten von Corona nutzt und damit täglich einem hohen Risiko der Infektion ausgesetzt ist, der gehört u.a. zu denjenigen, die aus den „poblaciones“ (Armenviertel) ins Zentrum zur Arbeit im Supermarkt, Krankenhaus etc. fahren und kein Auto zur Verfügung haben.
Nach wie vor gibt es einen drastischen Unterschied zwischen den öffentlichen und privaten Krankenhäusern. Auch wenn die privaten Betten für die Behandlung von Coronapatient*innen freigegeben werden sollen, so heißt es in einer Untersuchung des chilenischen Gesundheitssystems aus dem Jahre 2015, dass es generell an Krankenhäusern und Krankenbetten mangelt. Zudem soll es in öffentlichen Krankenhäusern an Personal und Grundausstattung wie Atemschutzmasken, Handschuhen und Desinfektionsmitteln fehlen. Des Weiteren kann es bis zu 60.000 Pesos (ca. 64,50 Euro) kosten, sich auf den Virus testen zu lassen. Allein wegen dieser Gebühr ist mit einer hohen Dunkelziffer zu rechen.
An dieser Stelle würde ich gerne auf zwei persönliche Erlebnisse eingehen, welche die Gegensätzlichkeit des Erlebens und der Wahrnehmung der Krise für mich noch einmal verdeutlicht haben.
In Peñalolen treffen zwei verschiedenste Realitäten aufeinander: Direkt an eine Gated Community grenzt die „población“ Peñalolens. Während in ersterer fast niemand auf den Straßen unterwegs war und mir höchstens ein paar Autos entgegenkamen, war das Leben auf der anderen Seite des Zauns ein vollkommen anderes. Kinder spielten auf dem Spielplatz, die Eltern unterhielten sich mit ihren Nachbar*innen, einige verkauften Kuchen auf der Straße, der Markt fand nach wie vor statt. Alles schien so zu sein, wie an einem ganz normalen Samstagnachmittag.
Eine andere Szene zeigte sich mir in einer Apotheke. Eine Türsteherin regelte den Einlass in die relativ kleine Apotheke. Als ich hereinkam, waren außer mir vier weitere Kund*innen im Laden. Aufgrund des mangelnden Raums und der Anzahl der Personen, war es für uns Wartende nicht möglich, den Sicherheitsabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Trotz allem waren Linien mit dem vorgesehenen Abstand auf dem Boden angebracht. Als ein wohlhabend aussehender Mann, ausgestattet mit Mundschutz und Handschuhen, gerade bezahlte, überquerte ein allem Anschein nach Betrunkener unbewusst die Linie. In diesem Moment wandte sich ersterer um und sagte: „Das ist der Grund, warum der Virus sich weiterverbreitet. Wegen Menschen wie Ihnen, die nicht auf die Vorschriften achten.“ Dabei ließ er außer Acht, dass wir davor zu dritt hinter der Absperrung zu ihm standen und er selbst den Abstand zur Kasse überschritten hatte, da einfach nicht genug Platz für die Anzahl der Menschen in der Apotheke war.
Ich teile diese so unscheinbar wirkenden Eindrücke aus dem Grund, weil ich denke, dass sie aufzeigen, wie schnell Narrative umschlagen können. Auch wenn es vermutlich unmöglich gewesen wäre, das Eindringen des Virus nach Chile komplett zu verhindern, hätte sich die Verbreitung durch den Verzicht auf Privilegien stark eindämmen lassen. Die Ignoranz der infizierten Ärzt*innen, Golfspieler*innen, Sportflugzeug- und Strandhausbesitzer*innen gefährden die Gesundheit ihrer Mitmenschen, welche es sich nicht erlauben können, sich zu infizieren bzw. in Quarantäne zu gehen. Auf Aussagen in den Sozialen Medien, in denen die Quarantäne dem Urlaub gleichgesetzt wurde, kamen zahlreiche Reaktionen, die in dieser ein Maß zur Bestimmung der Klasse sehen: „Disfrutar la cuarentena es un privilegio de clase“, „La romantización de la cuarentena es un privilegio de clase“.
Wer unter dem Virus leiden wird, ist die untere Klasse, und laut dem Apothekenbesucher sind diese auch Schuld an dessen Ausbreitung. In stark verkleinerter Weise spielte sich somit die Realität Peñalolens in diesen wenigen Quadratmetern der Apotheke ab. Ignoriert werden bei diesem Narrativ die Ursprünge der Infizierung und die tief verankerten sozialen Ungerechtigkeiten, welche das Einhalten der Vorschriften unmöglich machen, weshalb es zu ungerechtfertigten Anschuldigung kommt.
Die Krise um das Coronavirus unterstreicht nur noch einmal eine Großzahl der Probleme, für dessen Veränderung bereits seit Mitte Oktober letzten Jahres gekämpft wird: Rente, Krankenversicherung, Arbeiterschutz, Diskriminierung, Gewalt gegen Frauen — um nur wenige zu nennen. All diese Themen waren vielleicht noch nie so aktuell wie heute in Zeiten der Pandemie. Und ein weiteres Mal scheint die breite Masse nicht mit den Beschlüssen der Regierung einverstanden zu sein. So ist es vermutlich nur eine Frage der Zeit, bis es zu einer „Súper Reaparición“ der Demonstrationen kommt.
Delia Andreina García Martínez (19.04.2020): El Coronavirus ataca a Venezuela en su peor momento...
El Coronavirus ataca a Venezuela en su peor momento...
Delia Andreina García Martínez
19.04.2020
 |
Delia Andreina García Martínez es venezolana, estudió periodismo en Barquisimeto Venezuela. Es estudiante del Máster en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Hamburgo y reside en la ciudad hace cuatro años. |
Estoy en cuarentena desde que suspendieron las actividades escolares en la ciudad de Hamburgo, en Alemania, específicamente, desde el 16 de marzo. Apoyo la medida porque se hace con la finalidad de bajar la propagación del virus. Medida que seguirá mínimo hasta el 4 de mayo en la ciudad. Entre apoyar a mi hija con sus tareas y actividades escolares, terminar de escribir mi tesis de grado, cumplir con mis horas de trabajo semanales, pienso y doy gracias a Dios porque soy una persona afortunada. Por los momentos, mis familiares y amigos, están saludables. Para cumplir con mis responsabilidades, solo necesito una computadora y conexión a Internet.
Pero siento mucho y acompaño el sufrimiento de las personas que han perdido a sus familiares y amigos a causa del Coronavirus. Hasta hoy, según las cifras oficiales publicadas, hay 4.538 muertes en Alemania. Lamentablemente, muchas empresas locales han cerrados sus puertas, se han ido a la quiebra y algunos trabajadores y trabajadoras de los rubros más afectados por las restricciones tomadas, no tienen sus ingresos regulares mensuales. Para ellos, el estado Alemán creó programas de ayuda especial vigentes a partir del 1 de abril hasta septiembre de este año. Además, la sociedad se ha organizado para ayudar y hacer donaciones a través de fundaciones que apoyan a los más necesitados. Se están haciendo bien las cosas y los ciudadanos acatan las medidas.
Al principio de todo esto, al ir a los supermercados y ver la escasez de papel toalet y la compra desesperada y/o acaparamiento de algunas personas, producto de la incertidumbre causada por la situación; al ir a las farmacias y al ver los anuncios de la falta de mascarillas, guantes y desinfectantes, reviví un poco la situación de Venezuela con el desabastecimiento de productos. Pero no, a la final nada que ver, no se compara.
Durante la cuarentena también he escuchado quejas, personas que están inconformes porque no tienen tiempo para ellos, tienen más trabajo en casa, no pueden salir, asistir a fiestas grandes, a conciertos o eventos deportivos, no pueden hacer sus actividades como de costumbre, sus vacaciones programadas no podrán llevarse a cabo y recomiendan no planear viajes hasta finales de año. El llamado para ellos es al agradecimiento. La salud, un techo y la comida en la mesa, es lo más importante en estos tiempos. Cuidarnos y cuidar a los demás es la premisa. Dentro de todo, Alemania es un país privilegiado a nivel mundial, estable en lo político, en lo económico, con una infraestructura hospitalaria y un personal en el sector salud lo suficientemente bueno, que cuenta con todos los insumos y materiales necesarios para detectar el virus y tratarlo eficientemente.
En estos días, también me ha invadido un sentimiento de nostalgia y preocupación. Me he dado cuenta de que la cuarentena es un lujo, un privilegio de las clases sociales y de los países más beneficiados económicamente. Difícil la tienen mis compatriotas venezolanos, familiares y amigos que viven el día a día en una Venezuela que está en su peor momento para contrarrestar los efectos de esta pandemia mundial.
Desde el 16 de marzo se decretó la cuarentena en el país. Se suspendieron todos los vuelos desde y hacia Venezuela. Ciudadanos venezolanos quedaron varados en otros países y muchos reclaman que mientras otros países de la región han gestionado el regreso de sus ciudadanos que estaban de viaje al cerrarse las fronteras, ellos carecen de respuestas para regresar a Venezuela o a sus residencias en los diversos países (ya que muchos han emigrado últimamente por la crisis en Venezuela). Ahora desde el 18 de abril en Barquisimeto, la ciudad donde crecí y conservo familiares y amigos, se prohíbe la circulación de personas y vehículos después de las dos de la tarde.
Los ciudadanos viven una angustia total. La única solución que ven es acatar la cuarentena social lo máximo posible, puesto que si se enferman no tienen la seguridad de salir bien de todo esto. No tienen respaldo ni del gobierno ni cuentan con un sistema de salud adecuado para luchar contra el virus. Las infraestructuras de los hospitales públicos no son suficientes ni para los aislamientos, ni para las estaciones de los enfermos de covid-19; y al igual que en las clínicas privadas, no se tienen los insumos, medicamentos ni los equipos de prevención y seguridad para la población. Las reservas internacionales de Venezuela disminuyen cada vez más. La inflación y el mercado informal de divisas, aumentan sin cesar.
Hasta hoy se han reportado 227 infectados y 9 personas fallecidas. Pero, ¿quién da las cifras?, ¿realmente cuenta Venezuela con los recursos necesarios para hacer las pruebas de laboratorio pertinentes del covid-19? En casos anteriores como el virus del Zika que se propagó en el 2015 y 2016 en casi todo el continente americano, las autoridades venezolanas no publicaban la información suficiente ni fiable para que la población local e internacional estuviese al tanto de la evolución de la enfermedad.1 Ahora pasa lo mismo con el Coronavirus, la Universidad Johns Hopkins, que lleva estadísticas en el continente americano, publicó un gráfico actualizado el 15 de abril en el que muestra la cantidad de personas infectadas. En el renglón de Venezuela se lee: «Los datos otorgados por el gobierno son altamente sospechosos».2
Pero el “virus chino” como le dicen allá, no es la única preocupación de venezolanos y venezolanas. Desde hace ya algún tiempo, hay un alto índice de desnutrición. Se vive una gran crisis económica. Es un país con alta criminalidad y mucha inseguridad. Hay escasez de alimentos, medicinas, servicios básicos y ahora, escasez de gasolina, siendo un país que depende únicamente de la actividad petrolera. Se ve un país en “cuarentena” pero no todos pueden quedarse resguardados en sus hogares (quienes lo tienen). Además de que no todos tienen los recursos para trabajar o estudiar desde casa. Quienes pueden y tratan cumplir con las tareas, actividades escolares y con su trabajo, lo hacen cuando el servicio eléctrico se los permite, pues no todo el día cuentan con luz, por lo tanto, tampoco con Internet, ni con agua. Otros salen por la necesidad de trabajar, para poder mantenerse y sobrellevar la crisis.
Desde diciembre de 2017 se sufre en Venezuela un severo racionamiento de gasolina y diésel. Ya el consumo nacional se había desplomado de 600.000 barriles por día en el 2012 a 150.000 a inicios de este año. De estos, 110.000 se importaban. Pero desde el 18 de marzo, con el bloqueo, no pudieron llevar a Venezuela gasolina importada y empeoró la situación. Siempre había gasolina en Caracas, pero ahora ya se nota la escasez no sólo en el interior del país, sino también en la capital. Fuentes confiables me cuentan que desde mediados del 2019 las estaciones de servicio se manejan en conjunto con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), institución armada al servicio de la defensa de Venezuela, específicamente con el ZODI, Zona Operativa de Defensa Integral. Ellos exigen a las bombas de gasolina, tener una reserva sólo para ellos en caso de alguna emergencia. Tenían salvoconductos algunos sectores del servicio de salud y del gobierno, pero era un caos y una anarquía total manejada por la FANB. Quienes no tenían sus contactos duraban 3 y 4 días en cola para echar gasolina. Pero hoy día, casi todas las estaciones de servicio están cerradas. Se acabó lo que quedaba, ya que la producción nacional está prácticamente paralizada.
Ahora, las personas tienen que ingeniárselas aún más que antes para salir a buscar los alimentos y medicinas. Buscan ir como sea al trabajo. He escuchado, que muchos médicos se tienen que ir caminando a ver a sus pacientes. ¿Cómo funcionarán las ambulancias?, ¿como se van a distribuir los alimentos por el país?. Así como éstos, muchos otros rubros se verán desatendidos.
El gobierno se ha aprovechado de la cuarentena para que el pueblo se mantenga calmado y no se revele ante la falta de combustible. Lo peor de todo, es que a los revendedores de alimentos y medicinas del país, se le han sumado ahora, los revendedores de gasolina, quienes cobran tres dólares americanos por litro. ¿Qué sociedad es ésta?, ¿dónde están los valores y la solidaridad?.
En vez de aprovecharnos de la situación, necesitamos hoy más que nunca que todos los ciudadanos nos apoyemos los unos a los otros. Estamos solos en ésto. Somos una sociedad que puede decidir su destino y estoy segura que si cada quien pone de su parte, pronto saldremos bien de ésto. No se cuenta con el respaldo del gobierno, ellos están muy entretenidos. Se están disputando el poder. Por un lado: Maduro, apoyado por Rusia, China y Cuba. Por el otro: Guaidó apoyado por Estados Unidos y uno que otro país. A la final, ni uno ni el otro, ayudan en realidad a los ciudadanos venezolanos. Es por ésta inestabilidad política que se dificulta la asistencia humanitaria y financiera internacional. El llamado es a la ONU y las distintas ONG internacionales para que destinen su ayuda en función de la necesidad de los pueblos y no por afinidades políticas.
María Guadalupe Rivera Garay (05.04.2020): El mundo en la época de Coronavirus y qué significa para las comunidades indígenas
El mundo en tiempos de coronavirus y qué significa para las comunidades indígenas
María Guadalupe Rivera Garay
05.04.2020
Zuerst erschienen: Hmunts'a He̱m'i | Facebook
 |
María Guadalupe Rivera Garay, es mexicana y oriunda del Valle del Mezquital, es socióloga egresada de la Universidad de Bielefeld, Alemania e imparte seminarios en la Universidad de Hamburgo en el área de estudios latinoamericanos. |
Escribo este pequeño texto porque desde un poco antes de que se decretara la cuarentena a causa del coronavirus en Alemania, que es el lugar donde actualmente vivo, me llegaron muchísimas preocupaciones, principalmente de lo que puede pasar en las comunidades indígenas si la pandemia llega a sus pueblos.
Aquí, del otro lado del mundo, se han tomado medidas extremas que nunca había vivido. La precaución y la inquietud se siente con todos. El estado alemán manifestó preocupación desde antes de que llegara el virus al país y empezó a prepararse. Las medidas de prevención que el estado fue tomando, tanto en la vida cotidiana de los ciudadanos como en el sistema de salud ante esta crisis, preocupó a la población y, personalmente, tomé conciencia de la dimensión que este problema significaba. Lo hice porque un país con uno de los mejores sistemas de salud, una estabilidad económica y la confianza en sus instituciones de la salud y la política se preparaba y, al mismo tiempo, preparaba a sus ciudadanos a tomar conciencia de lo que nos esperaría en las próximas semanas y de lo mucho que cambiaría esto en nuestras vidas. Hoy, después de tres semanas de cuarentena, percibimos que esto durara más, ya que, aunque parece que todo se encuentra bajo control al ser Alemania uno de los países europeos mejor preparados ante esta epidemia, la cancillera y el responsable de salud han comunicado que nos esperan semanas duras. Han afirmado, además, que no se descarta la saturación del sistema de salud y la muerte de miles de personas, conjuntamente a los efectos sociales, económicos y psicológicos que esto traerá a nuestras vidas.
Ante este panorama, he pensado mucho en México y en los grandes retos que enfrentará ante la gran desigualdad social, los enfrentamientos políticos, la poca credibilidad del estado, el desabasto en el sistema de salud pública y los grandes problemas relativos a enfermedades degenerativas y obesidad. Algunos de mi familia que viven y trabajan en los sectores de salud y educación en el Valle del Mezquital cuentan de las dificultades de lograr una adecuada información sobre las implicaciones de esta epidemia global. Igualmente, indican la poca credibilidad de las instituciones estatales, en cuanto a comprender que el coronavirus es un problema real y que se tiene que tomar en serio. Mi amigo Abddel ayer me decía: “En México se está acostumbrado a vivir en algún tipo de crisis por lo que ésta es una más de la que se saldrá bien. Se percibe un ambiente reflexivo. Mucha gente se lo toma en serio y son pocos los que no… Saldremos de esto”, asegura. Eso da esperanza e igualmente creo que así será, pues el país siempre se ha caracterizado y salvado gracias a la solidaridad y lucha de sus habitantes en situaciones de crisis. La sociedad civil ha reaccionado adecuadamente en momentos difíciles, la solidaridad y la lucha de todos los días sale con más fuerza en momentos difíciles, como en septiembre del 2017 cuando ocurrió el terremoto en la ciudad de México. En aquel momento la solidaridad fue enorme y la ayuda ejemplar y eso es un recurso de suma importancia que ahora a veces olvidamos.
Sin embargo, en las comunidades indígenas que viven otras realidades e históricamente han sido golpeadas por crisis sociales, políticas y económicas, me preguntaba sobre lo que pasará con nuestras familias, amigos y vecinos que enfrentan múltiples desigualdades y nulo acceso a la salud y el bienestar social. Me sobresalta esta preocupación, pero también me hace recordar y regresar a la memoria histórica… de los momentos difíciles de crisis que viví de pequeña y fueron solucionados.
Recuerdo la amenaza de la llegada del chupacabras… que a todos sobresaltó y que era más un rumor que realidad, pero en la comunidad en donde crecí se organizó la gente, se celebraban asambleas y se organizaban vigilancias para hacer guardias en las entradas y salidas de la comunidad, y así controlar el ingreso y salida de las personas. Las comunidades del municipio se coordinaban entre sus delegados para reconocer y actuar conjuntamente en caso de entradas y salidas de sospechosos. Así pienso que, en este momento, con la llegada del coronavirus a las comunidades y ante la carencia de insumos de salud necesarios, las comunidades son las mejor calificadas para enfrentar esta pandemia. Lo creo pues en ellas, aunque no se tengan los insumos, la atención médica y los enseres de las ciudades, se tienen los saberes milenarios y las experiencias que han pasado y pueden prevenir adecuadamente a partir de sus formas de organización, coordinación, ayuda mutua, solidaridad y formas de alimentación.
Mi papá me decía: “Aquí no nos vamos a morir de hambre, maíz y frijol tenemos y ya va a llegar el tiempo de los quelites.” Las comunidades tienen sus saberes de sobrevivencia, saben trabajar la tierra que históricamente los ha sacado de las crisis, no tienen lo que aquí o en las ciudades de México se conoce como “progreso y educación”, sino calificaciones y ética de trabajo para enfrentar catástrofes y crisis sociales, naturales y económicas que lamentablemente por el sistema clasista y racista no son reconocidos como tales. Existe una historia ejemplar de un pueblo originario en el Océano Índico, cuando ocurrió el gran tsunami. Se trata de una isla que está aislada y sin comunicación, por lo que se pensó que sus habitantes habían muerto como consecuencia del tsunami. El gobierno hindú envió helicópteros para ver qué había pasado con ellos. Este grupo originario, conocedor de navegación, del mar y orientación en la selva, así como de las señales que la naturaleza envía ante estas catástrofes, se había retirado a las zonas más altas de su isla y así las personas se habían salvado en comparación con otros lugares donde había cientos de muertos.
Queridos vecinos, familia, compatriotas, tenemos que reaccionar de acuerdo con nuestros recursos. Hermanos de las comunidades, aún están a tiempo de actuar: recuerden a nuestros antepasados, nuestras costumbres y tradiciones. Protéjanse mutuamente, eviten contacto con personas externas, aíslen a sus visitas y coordínense entre comunidades para saber quién entra y sale, como le hacían con el chupacabras o con los asaltantes. Aíslense si es necesario, como decía mi papá: “De hambre no se van a morir, nopales, quelites, etc. tenemos”, ningún vecino negará una tortilla a otro vecino. Sólo de esta forma evitaremos la llegada y los estragos del virus, que lamentablemente es real y amenaza a las comunidades si no se unen y toman las debidas precauciones.
Mi papá, desconfiado del sistema de salud, siempre ha dicho: “Llegar a un hospital significa la muerte.” Hay que escucharlos a ellos, los mayores. Ellos tienen la sabiduría y la experiencia frente a lo que nos llega de fuera, saben como reaccionar para protegernos, pues mientras actuemos en comunidad tendremos mejores posibilidades de salir de esta crisis. Con solidaridad, responsabilidad y ética muy presente en nuestras comunidades podemos reemplazar aquello de lo que se teme carezcan en las ciudades, me refiero a atención médica, desabasto de alimentos y la confianza de tener un lugar de descanso, seguridad y tranquilidad pues la seguridad, tranquilidad y solidaridad eso es lo que caracteriza a nuestros pueblos.
Protéjanse y protejan a los demás. La salud y estar juntos es lo más importante.
Mónica Albizúrez (19.03.2020): Tiempo de coronavirus, tiempo de números. Desde Hamburgo
Tiempo de coronavirus, tiempo de números. Desde Hamburgo
Mónica Albizúrez
19.03.20
Zuerst erschienen: gazeta
|
|
Es doctora en Literatura y abogada. Se dedica a la enseñanza del español y de las literaturas latinoamericanas. Reside en Hamburgo. Vive entre Hamburgo y Guatemala. El movimiento entre territorios, lenguas y disciplinas ha sido una coordenada de su vida. |
Regresé de Guatemala a Hamburgo el 4 de marzo de 2020, con cierta alarma por el coronavirus, cuando ya había 3089 infectados en Italia y se empezaba a mencionar que la rapidez del contagio no era una exageración de los más alarmistas. Sin embargo, en ese viaje no presagié la contundencia de la pandemia.
Han sido días en los que me he acostumbrado a revisar cifras. Un farmacéutico de uno de los pueblos más golpeados por el coronavirus, Alzano Lombardo, en la provincial de Pergamo, decía que había aprendido que las epidemias son cuestión de matemáticas. Hay un punto de inflexión, cuando se cuentan diariamente los muertos y los recuperados, cuando se vuelven a contar camas de hospitales y se escoge quién la ocupa y quién no, cuando se oyen campanas de las iglesias que anuncian los muertos. Este farmacéutico pregunta diariamente a quienes llegan a la farmacia, cuántas personas están en la casa, cuántos cuartos hay, cuánta distancia guardan entre todos, cuántos años tienen quienes presentan síntomas. Mientras él habla con la reportera Francesca Borri (TAZ 14/03/2020) entran nuevos clientes en la farmacia. Ya contarlos, no se puede.
Pensaba que esa es la dinámica de este encierro en este tiempo. Revisar la curva ascendente del coronavirus varias veces al día. Revisar los mapas digitales para comparar efectos. Contar más las horas del día, porque trabajo en la casa hay, pero el encierro obligado marca con más fuerza la división del tiempo.
Y también se cuenta la espera. La espera para que esa curva del coronavirus ceda y empiece la bajada. La espera para tener más respuestas sobre esta crisis que, pasadas las fiestas del año nuevo, solo era una enfermedad preocupante en las entrañas de una región de China. Era la narración de un mercado, en Wuhan, cuyas imágenes de tráfico y consumo de especies animales interpelan sobre un mundo natural del que somos parte y que muchas veces olvidamos.
Una parte de mí esta en Hamburgo, en mi barrio, Ottensen, de orígenes autonómicos y donde tuvieron lugar luchas heroicas contra el nazismo. Hoy es un barrio que se va gentrificando demasiado rápido, pero que todavía guarda almacenes turcos, como costurerías, a donde siempre voy porque la ropa alemana siempre me será demasiado grande. Esas costurerías, llenas de hilos de colores, de sonidos de máquinas de coser y de un acento extranjero, el de las grandes olas migratorias turcas de los años sesenta, están cerradas. Al ir a comprar comida, es muy raro pasar enfrente de ellas y otear su oscuridad.
En este barrio, como en toda Alemania donde todavía al momento de escribir no hay toque de queda, existen aún rastros de algún transeúnte y de bicicletas, no es el desierto de otras partes de Europa, pero el silencio habita en la calle.
Mientras tanto, los números siguen desplegándose en las pantallas del mundo interior en el que estamos confinados. He perdido un poco la capacidad de interpretar y menos de prever. Me da miedo que luego vengan los números del resultado de esta crisis, números humanos pero también económicos.
La primavera está por venir. El 20 de marzo
Danksagung | Agradecimientos
[DE] Die Lateinamerika-Studien Hamburg bedanken sich bei allen Autor:innen für die Bereitstellung ihrer Texte und ihr Engagement. Zudem danken wir Mónica Albizúrez und María Guadalupe Rivera Garay für Unterstützung beim Lektorat der Texte und Leon Schepers für die technische Umsetzung.
[ESP] Los Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Hamburgo desean agradecer a todos los autores por brindar sus textos y su compromiso. También queremos agradecer a Mónica Albizúrez y María Guadalupe Rivera Garay por su apoyo en la edición de los textos y a Leon Schepers por el soporte técnico.

