Abstracts
Zwischen Umweltzerstörung und ländlicher Idylle: Osteuropa in ökologischer Perspektive
Ringvorlesung der Osteuropastudien Wintersemester 2021/22
03.11.2021
Mit langem Atem: Die Umweltsituation der Ostsee vor dem Hintergrund der Bemühungen der Umweltorganisationen, der Aktivitäten von EU und der Helsinkikonvention
Jochen Lamp, Leiter des WWF-Ostseebüros
Der Umweltzustand der Ostsee ist auch im Jahr 2021 noch schlecht - schlechter, als er entsprechend der vereinbarten Zielsetzungen sein sollte. Der Vortrag skizziert wesentliche Entwicklungen vor dem Hintergrund der politischen Zielsetzungen und der politischen Wende und später der EU Erweiterung, reflektiert aus Sicht eines Umweltakteurs Mitgestaltungsmöglichkeiten von Umweltverbänden und versucht einen Ausblick nach heutigem Stand zu geben - unmittelbar nach der Ministerkonferenz im Oktober in Lübeck, wo es um die Fortschreibung des Ostseeaktionsplans nach 2021 ging.
Zum Blog von Jochen Lamp beim WWF
-----------------------------------------------------------------
10.11.2021
Wisent-Wildnis und Welterbe. Der polnisch-belarusische Nationalpark von Białowieża
Prof. Dr. Thomas Bohn, Historisches Institut, Justus-Liebig-Universität Gießen
Der an der polnisch-belarusischen Grenze gelegene Wald von Białowieża galt seit dem 18. Jahrhundert als letzte Zufluchtsstätte des Wisents, der im Ersten Weltkrieg nahezu ausgerottet wurde. Internationale Bedeutung erlangte der letzte Flachland-Urwald Europas zunächst als Jagdgebiet für polnische Könige und russische Zaren, dann als polnischer und belarusischer Nationalpark und schließlich als UNESCO-Welterbe.
Der Vortrag nimmt die Geschichte des Waldes von der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart in den Blick. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem 20. Jahrhundert mit seinen vielfältigen machtpolitischen Wandlungen. Im Vordergrund stehen Fragen der institutionellen und personellen Durchherrschung der Region unter verschiedenen politischen Ordnungen, vor allem im Hinblick auf den Umgang mit der Natur als Ressource und Reservat, sowie der Alltag der Bevölkerung und ihrer Konfrontation mit äußeren Faktoren und der vertrauten Lebenswelt.
Thomas Bohn (Personalseite Universität Gießen)
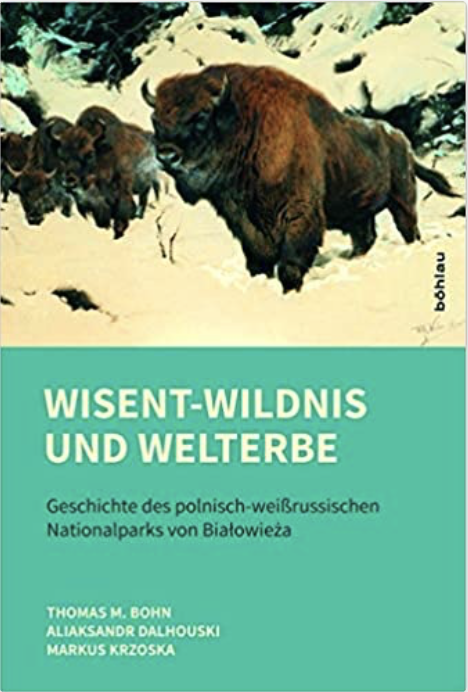 |
Thomas Bohn, Aliaksandr Dalhouski und Markus Krzoska: Wisent-Wildnis und Welterbe. Geschichte des polnisch-weißrussischen Nationalparks von Białowieża. Köln/Weimar/Wien 2017. |
----------------------------------------------------------------
17.11.2021
Von der Umwelt zur Unabhängigkeit. Die grünen Bewegungen in der Estnischen und Lettischen SSR 1985 bis 1991
PD Dr. David Feest & Detlef Henning, M.A., Nordost-Institut Lüneburg
In Folge der Reformpolitik Michail Gorbačevs (ab 1985 ) und nach dem Reaktorunglück von Černobyl (April 1986) wurden in der Estnischen und Lettischen SSR erstmals Bürgerproteste artikuliert, die vordergründig auf Umweltprobleme aufmerksam machten: in Nordost-Estland auf die geplante Erweiterung des Abbaus von Ölschiefer, der etwa ein Drittel der Estnischen SSR ökologisch betroffen hätte, und in der Lettischen SSR der Bau eines weiteren Wasserkraftwerkes an der Daugava (dt. Düna), der Teile des kulturell und ökologisch wertvollen Flußtales zerstört hätte. Allerdings wurde rasch klar, dass sich die estnischen und lettischen Umweltvereine, die teilweise aus älteren baltischen Folklorebewegungen hervorgingen, eher einem kulturellen als einem natürlichen Ökologiebegriff verpflichtet fühlten und folgerichtig in den darauffolgenden Jahren in die nationalen Unabhängigkeitsbewegungen der baltischen Sowjetrepubliken einmündeten. Die Veranstaltung gibt einen Überblick über die historischen Wurzeln und die Politik der „grünen“ Bewegungen im Baltikum Ende der 1980er Jahre, deren Unterschiede zu ökologischen Bewegungen im Westen und weitere Entwicklung nach Wiederherstellung der staatlichen Unabhängigkeit.
-----------------------------------------------------------------
24.11.2021
Sehnsuchtsort und „schmutzigstes Meer der Welt“ – Zur Umweltgeschichte des Ostseetourismus
Dr. Jan-Hinnerk Antons, Geschichte Ost- und Ostmitteleuropas, Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg
Die Geschichte des Ostseetourismus ist eng mit dem Mensch-Natur-Verhältnis, oder genauer: Mensch-Meer-Verhältnis, verknüpft. Denn seine Entstehung basiert auf einer ersten neuzeitlichen Wende in der Wahrnehmung des Meeres im 18./19. Jahrhundert. Von einem angsteinflößenden Element wurde das Meer zu etwas Erhabenem und Gesundem und damit ein präferiertes Ziel des entstehenden modernen Tourismus. Eine zweite Wende in der Wahrnehmung des Meeres um das Jahr 1970 entzog dieser Perspektive jedoch die Basis, denn nun galt die vom Menschen verschmutzte Ostsee als Gesundheitsgefahr. Entlang dieser Perspektivverschiebungen möchte ich in der Vorlesung den Fragen nachgehen, welche Naturreize die Ostsee als Genesungs- und Erholungsraum etablierten und wie ihre spätere diskursive Verkehrung in ein gesundheitsgefährdendes Element den Tourismus beeinflusste. Welche Reaktionen zeigten Tourist:innen, staatliche Akteure und die Tourismuswirtschaft auf die ökologischen Probleme? Welche Wirkungen hatte andererseits der Tourismus auf die Natur?
-----------------------------------------------------------------
01.12.2021
Ecological Justice and Gender in the Russian Arctic
Dr. habil. Natalia Kukarenko, Northern Arctic Federal University, Arkhangelsk
Globalization and climate change pose many new challenges and threats for individuals and communities in the Arctic generally. At the same time ecological justice issues have become a heated topic of public discussions in Russian Arctic due to several episodes/ accidents in the last decade which led to some public actions and activities both off- and on-line.
In my lecture I will start with a brief discussion on ecological justice as a concept and will provide some theoretical approaches. Then I will discuss how gender perspective allows enhancing our understanding of ecological justice disparities for men and women and what dispositions are available to both genders for action to achieve ecological justice. In the third part of my lecture I will provide some examples from the Russian part of Arctic.
-----------------------------------------------------------------
08.12.2021
Impacts of Arctic Warming - Die Erwärmung der Arktis und ihre Folgen
Dr. Jakob Belter, Sektion Meereisphysik,Alfred-Wegener-Institut, Bremerhaven
Während in der Politik über das 1.5 Grad Ziel der kommenden Jahre diskutiert wird, werden in der Arktis bereits heute Temperaturen gemessen, die knapp 4 Grad über den langjährigen Mittelwerten liegen. Die globale Erwärmung schreitet in der Arktis also deutlich schneller voran, was Einfluss auf das arktische Klima- und Ökosystem, aber auch auf das Wetter und Klima in Europa hat.
Aufgrund der abgelegenen Lage und der harschen Bedingungen bieten uns Satelliten und Modelle die besten Möglichkeiten die Veränderungen in der Arktis zu beobachten und vorherzusagen. Beide Ansätze basieren allerdings auf Annahmen über die dominanten Prozesse, die die Eisbedeckung beeinflussen. Um diese Prozesse und deren Folgen besser zu verstehen sind großangelegte und logistisch aufwendige Expeditionen wie MOSAiC elementar wichtig.
-----------------------------------------------------------------
15.12.2021
Poetry and the Anthropocene: Ecological Initiatives and Poetic Interventions in Poland
Prof. Dr. Julia Fiedorczuk, Institute of English Studies, Universität Warschau
What is the impact of contemporary planetary crises - climate change, the loss of biodiversity, migration crisis - on our poetic practices? These interrelated crises, adding up to what is widely referred to as the Anthropocene, involve a profound material transformation of our reality and of the ways we think about ourselves in relation to the more-than-human world. How does poetry tap into those changes, how can it help us think through this moment without escapism but also without falling for apocalyptic scenarios (which are a form of denialism)? I would like to suggest that poetry, as an art which uses units of sound and sense for its building material is an especially interesting field of experiment today because it underscores the inseparability of matter and meaning ("nature" and "culture"). It questions anthropocentrism and attempts to articulate new forms of being with the world. In my talk I will describe my own artistic practices related to the set of questions outlined above as well as mention several other Polish and American poets.
-----------------------------------------------------------------
05.01.2022
Das Zeitalter des Menschen als Vermächtnis des Kalten Krieges? Vorläufer des Anthropozän-Denkens
Ann-Kathrin Benner, M.A., Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik (IFSH), Hamburg
In den vergangenen Jahren hat die These an Popularität gewonnen, dass wir in einem neuen geologischen Erdzeitalter leben, dem Anthropozän. Befürworter:innen dieser Idee gehen davon aus, dass die Menschheit einen dominanten geophysikalischen Einfluss auf das Erdsystem gewonnen hat. Für viele leitet sich daraus die Vorstellung ab, dass die Menschheit eine besondere Verantwortung für die Zukunft des Planeten hat.
Als Ausgangspunkt der Debatten um das „Zeitalter des Menschen“ wird häufig ein Aufsatz von Paul Crutzen und Eugen Stoermer aus dem Jahr 2000 angegeben. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich jedoch, dass der Begriff des Anthropozäns sich aus vielfältigen Erzählsträngen zusammensetzt, von denen einige eng mit dem kulturellen, technologischen und politischen Vermächtnis des Kalten Krieges verknüpft sind.
In diesem Vortrag soll es um verschiedene „Ursprungsgeschichten“ des Anthropozäns diesseits und jenseits des Eisernen Vorhangs gehen. Es soll der Frage nachgegangen werden, unter welchen Bedingungen die Erde als Erdsystem und die Menschheit als geologischer Akteur vorstellbar wurde(n) und was dafür (und dagegen) spricht, das Anthropozän als zweifelhaftes Erbe des Kalten Krieges zu deuten.
-----------------------------------------------------------------
12.01.2022
Klimawandel im hohen Norden Russlands: Wie Rentierhirten die Veränderungen in der Tundra beschreiben
Prof. Dr. Joachim Otto Habeck, Institut für Ethnologie, Universität Hamburg
Der globale Klimawandel verursacht besonders starke ökologische Veränderungen in der Arktis und im Hohen Norden Russlands – davon war in dieser Ringvorlesung bereits die Rede. Dieser Vortrag knüpft daran an und beleuchtet die Situation der indigenen Bevölkerung in Nordwestsibirien. Für diese ist die Rentierhaltung eine wichtige ökonomische und kulturelle Grundlage. Nach einer kurzen Einführung zur allgemeinen Situation der Rentierhaltung in dieser Region werden folgende Fragen erörtert: Wie nehmen die Rentierhalter die klimatischen Veränderungen wahr? Wie deuten sie die Ursachen und Dynamiken? Wie reagieren sie auf die sich rapide wandelnden ökologischen, aber auch wirtschaftlichen Bedingungen? Diesen Fragen wird auf Grundlage der Zwischenergebnisse des EU-Projekts CHARTER nachgegangen. Ein spezieller Punkt betrifft das Auftauen von Permafrostböden und der zu erwartenden, teilweise bereits sichtbaren Konsequenzen: Inwieweit sind indigene Gruppen im Hohen Norden Russlands die Opfer einer solchen Entwicklung? Einige Expert:innen vertreten die These, dass gerade die Rentierhaltung einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Permafrost-Ökosysteme leisten kann. Ob und wie eine solche Form des bio-geo-engineering umgesetzt werden kann, wird zum Ende dieses Vortrags zur Diskussion gestellt.
-----------------------------------------------------------------
