Grammatiklernen macht Sinn
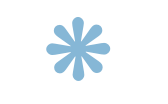
Grammatiklernen macht Sinn
Es ist ganz einfach: ohne Grammatik keine Sprache, denn es gäbe keine Struktur, an der Sie sich beim Sprechen/Schreiben oder Hören/Lesen orientieren könnten. Sprachverwirung und Missverständisse wären vorprogrammiert, weil Ihnen die "Baupläne” für die Sprachproduktion und das Sprachverstehen fehlten. Für eine gelungene Kommunikation ist Grammatik unabdingbar, weil sie für den Textzusammenhang, auch Kohärenz genannt, sorgt. Diese kommunikative Funktion kann sie nur erfüllen, wenn Form und Funktion sprachlicher Ausdrücke fest aufeinander bezogen sind. Grammatik hat daher – wie auch andere Sprachbereiche – ihre eigenen Gebrauchsvorschriften, d.h., sie hat eine Sprachnorm. Sie lernen eine Fremdsprache nur dann erfolgreich, wenn Sie sich um ihre Grammatik bemühen. Häufige Normverstöße können dazu führen, dass Ihr Gegenüber Sie nicht versteht oder Sie ablehnt, weil Sie "falsch" sprechen oder schreiben.
Grammatik ist ebenfalls (wie auch Wortschatz) ein Werkzeug zur Formulierung von Gedanken bzw. Erkenntnissen (die sog. kognitive Funktion von Grammatik). Sie stellt Ihnen verschiedene Ausdrucksmittel zur Auswahl, mit denen Sie Sachverhalte, über die Sie kommunizieren wollen, so gliedern und differenzieren können, wie Sie sie tatsächlich wahrnehmen oder wie Sie sie für Ihre GesprächspartnerInnen darstellen wollen. Beispiel
Unter "Grammatik" versteht man genau genommen mehrere Möglichkeiten, die Struktur einer Sprache zu fassen.
Da jede Sprache eine nur für sie charakteristische Grammatik hat, kommt man am Grammatiklernen nicht vorbei. Dafür kann man unterschiedliche Wege wählen. Welche Möglichkeiten es gibt, sollen Ihnen die folgenden Lerntipps zeigen. Welche dieser Anregungen am besten auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind, müssen Sie selbst herausfinden.
Plädoyer für die Notwendigkeit wissensbasierten Grammatiklernens
Sprache kann zur Sicherung ihrer kommunikativen Funktion auf Grammatik nicht verzichten, viele Lerner dagegen sehr wohl, denn sie kommen gut ohne Grammatiklernen aus. Diese Lerner haben die Erfahrung gemacht, dass das Auswendiglernen einer grammatischen Regel und ihre Anwendung in der fremdsprachlichen (außer)unterrichtlichen Kommunikation zwei verschiedene Dinge sind. Sie empfinden zudem häufig Grammatik als trocken, formal, langweilig u.ä. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass der eher negativen lernerseitigen Einschätzung zur Wichtigkeit von Grammatiklernen ein Anteil von 40 bis 60% der Gesamtunterrichtszeit im Fremdsprachenunterricht gegenübersteht (Zimmermann 1984, S. 40). Offensichtlich wird die Rolle der Grammatik für das Fremdsprachenlernen von Lehrern weitaus positiver bewertet.
Auch in der Sprachlehrforschung sind die Auffassungen über Grammatiklernen (und -lehren) geteilt, wofür unterschiedliche Wissenschaftstraditionen, nordamerikanische vs. (kontinental)europäische, ausschlaggebend sind. Die Meinungen über den Beitrag, den grammatische Kenntnisse zum Erlernen einer Fremdsprache leisten, sind zwischen den Extrempositionen "unmittelbare Lernhilfe" und "pure Zeitverschwendung" breit gestreut.
Die "Grammatik als unmittelbare Lernhilfe"-Position, auch "strong interface-positio" genannt, wird von Forschern vertreten, die auf kognitionspsychologischer Grundlage argumentieren. Sie unterscheiden zwischen deklarativem, explizitem Wissen einerseits, das man äußern kann ("man weiß etwas"), und prozeduralem, implizitem Wissen andererseits, das dem sprachlichen Handeln zugrunde liegt ("man kann etwas"). Sie gehen ferner davon aus, dass zunächst bewusst gelerntes deklaratives (Grammatik-)Wissen durch wiederholtes Üben automatisiert und auf diese Weise in prozedurales unbewußtes (Grammatik-)Wissen übergeht.
Bei der "Grammatik als pure Zeitverschwendung"-Position, auch "zero
interface-position", genannt, handelt es sich um die zur "Grammatik als unmittelbare Lernhilfe"-Position entgegengesetzte Auffassung. Erfolgreich eignet man sich eine Fremdsprache dann an, wenn Fremdsprachenerwerb (language
acquisition) stattfindet. Damit ist ein unbewusster, nichtintentionaler Prozess gemeint, der ausschließlich durch kommunikative Erfahrung über verständlichen natürlichen Input ausgelöst
wird und dabei möglicherweise den angeborenen Erstspracherwerbsmechanismus
(re)aktiviert. Er ist durch Steuerung von außen, z.B. durch Unterricht,
nur bedingt beeinflußbar. Fremdsprachenlernen (language learning) dagegen ist ein bewusst und intentional ablaufender Prozess. Nach der "Grammatik als pure Zeitverschwendung"-Position führt er nicht zum Erwerb, sondern nur zu einer gelernten Kompetenz, d.h. zu bewußt angeeigneten (Grammatik-)Kenntnissen. Diese können Lerner lediglich einsetzen, um geplante Äußerungen auf Korrektheit hin zu kontrollieren, z.B. beim Schreiben, nicht aber um in der Fremdsprache in natürlichen Situationen spontan zu kommunizieren.
Eine vermittelnde Position zur Rolle grammatischen Wissens für das Fremdsprachenlernen
beziehen Forscher, die Grammatikkenntnissen, unabhängig von ihrer Repräsentationsform
(als explizites oder implizites, d.h. als bewußtes, äußerbares
oder unbewußtes, nicht äußerbares Wissen) und ihrer Aktivierung
(kontrollierter, automatischer Zugriff), eine "aufmerksamkeitserregende" ("consciousness-raising") Funktion zusprechen. Diese Position zum
Beitrag grammatischen Wissens für erfolgreiches Fremdsprachenlernen wird
auch "weak interface-position" genannt.
Sie hat sich im Zuge der Diskussion herauskristallisiert, die seit einiger Zeit
in der Sprachlehrforschung um das Konzept von language awareness (Sprachbewußtheit)
geführt wird.
Es spricht einiges für die Auffassung, dass grammatisches Wissen wegen seiner "aufmerksamkeitserregenden" Funktion den Lernprozess unterstützen kann. So ist bekannt dass (zumindest erwachsene) Lerner nur ganz selten das Niveau von Muttersprachlern erreichen, wenn sie einem intensiven Kontakt mit der Fremdsprache ausgesetzt sind und diese im Sinne der "zero interface-position" erwerben. Solche Erwerbskontexte können z.B. Langzeitintensivkurse oder ein längerer Aufenthalt im Zielland sein, wobei die Fremdsprache wegen des unbegrenzten Zugangs mitunter sogar zur Zweitsprache der Lerner geworden ist. Bewusst gelerntes Grammatikwissen schadet erworbenem Wissen keinesfalls, sondern es festigt diesen Wissensbestand. Ausschließlich natürlich erworbenes Wissen hingegen ohne bewusst gelernte Anteile führt häufig zu einer lückenhaften Kompetenz in der Fremdsprache. Nichts spricht daher für eine prinzipelle Ablehnung von Grammatiklernen.
Sprachnorm
Mit Sprachnorm ist hier das "sprachlich/grammatisch Korrekte” gemeint, so wie es z.B. durch grammatische Handbücher für die dt. Standardsprache fest- und vorgeschrieben und durch Bildungseinrichtungen (v.a. Schulen und Hochschulen), Medien u.ä. verbreitet und z.T. überwacht wird. Diese Normvariante wird als (kodifizierte) präskriptive Sprachnorm bezeichnet. Normverstöße führen zu sozialen Sanktionen, z.B. zu schlechten Noten in der Schule, Geringschätzung des Gesprächspartners bis zum Kommunikationsabbruch.
Wegen ihrer breiten Verwendungsmöglichkeiten ist die präskriptive Sprachnorm der Standardsprache das wichtigste Lernziel beim Fremdsprachenlernen. Nur sie garantiert, dass (fremd)sprachliche Kommunikation in allen Situationen möglichst risikolos, d.h. frei von Sanktionen verläuft. Dem (didaktisch orientierten) präskriptiven Normbegriff steht die (linguistisch orientierte) deskriptive
Sprachnorm gegenüber. Sie zielt auf den tatsächlich vorkommenden Sprachgebrauch ab und umfasst somit auch Ausdrucksformen, die präskriptiv zwar "falsch", gleichwohl weit verbreitet sind wie z.B. dt. "die
einzigste/optimalste (anstelle: einzige/optimale) Lösung. Lass
uns nach (anstelle: zu) Aldi gehen! Wir haben mehrere Alternativen
(anstelle: eine Alternative)”
Hinter dem Etikett "Grammatik" verbergen sich verschiedene Begriffe
Mit Blick auf das Lernen fremdsprachlicher Grammatik lassen sie sich nach ihrer
Existenzform und nach ihrer Funktion voneinander abgrenzen.
Zu unterscheiden ist die interne Grammatik von der externen Grammatik. Die interne Grammatik umfaßt die beiden Untertypen:
- Grammatik als das spezifische System von Zuordnungsbeziehungen zwischen Formen und Inhalten sprachlicher Ausdrücke, über das jede Sprache verfügt. Diese Grammatik, auch inhärente Grammatik genannt, existiert unabhängig von ihrer Beschreibung und ihren Benutzern.
- Grammatik als das subjektive, häufig unbewußte Wissen um die Regularitäten der inhärenten Grammatik, über das Lerner verfügen und das sie befähigt, die Fremdsprache zu verwenden. Diese Grammatik, auch subjektive, internalisierte, mentale Grammatik oder Lernergrammatik genannt, existiert ebenfalls unabhängig von ihrer Beschreibung. Sie hängt jedoch von ihren Benutzern ab, denn sie setzt sich aus den Annahmen jedes einzelnen individuellen Lerners über die fremdsprachliche Grammatik zusammen.
Bei der externen Grammatik handelt es sich um explizite und direkt zugängliche Beschreibungen oder Modellierungen der internen Grammatik, die verschiedene Zwecke verfolgen. Ihre typische Form ist das (Hand)Buch, für Sprachlernzwecke neuerdings auch computergestützte Medien. Externe Grammatiken können folgende Funktionen haben:
- als (deskriptive) wissenschaftliche Grammatik ist sie zumeist in Anlehnung an ein bestimmtes linguistisches Modell eine umfassende und detaillierte Beschreibung des (fremd)sprachlichen Regelsystems.
- als didaktische Grammatik oder Lehrgrammatik dient sie dazu, den Fremdsprachenunterricht so zu planen und zu gestalten, dass Lernprozesse angeregt, ausgelöst und effektiv gesteuert werden können.
- als Lerngrammatik oder Grammatik für Lerner unterstützt und fördert sie das außerunterrichtliche autonome Fremdsprachenlernen (unglücklicherweise wird sie bisweilen auch als Lernergrammatik bezeichnet).
Weitere Grammatiktypen, die sich mit den obengenannten teilweise überlappen,
sind normative Grammatiken (Grammatiken zu Zweifelsfällen),
kontrastive bzw. konfrontative Grammatiken (beschreiben Unterschiede
bzw. ebenfalls Gemeinsamkeiten von zwei oder mehreren Sprachen, z.B. für
den Fremdsprachenunterricht) und Theoriegrammatiken (erläutern die
Ausführbarkeit von sprachtheoretischen Programmen).
Lehr- und Lerngrammatiken berücksichtigen für Auswahl, Anordnung und
Präsentation der fremdsprachlichen Mittel und Strukturen, die sie ihren
Adressaten anbieten, sprach- und lernpsychologische sowie pädagogische
Gesichtspunkte.
Im Idealfall verläuft Grammatiklernen so, dass der Lerner seine Lernergrammatik Schritt für Schritt der inhärenten Grammatik der Zielsprache annähert. Allerdings kann die Sprachlehrforschung bislang nur wenige gesicherte Erkenntnise zu der Frage vorweisen, wie Lerner sich Grammatik aneignen, speichern und verwenden. Vorliegende Grammatiken beruhen daher auf nicht endgültig abgesicherten lern- und sprachpsychologischen Annahmen. Sie stellen nur ein Angebot an den Lerner dar, seinen Fremdsprachenerwerb zu optimieren. Für das individuelle oder unterrichtliche Lernen der Fremdsprache außerhalb des Ziellands ist dieses Angebot jedoch ohne Alternative.
Hat man dauerhaft unbegrenzten Zugang zur Fremdsprache, z.B. bei längerem Aufenthalt und Sprachkontakt im Zielland, wird man weniger auf eine Lerngrammatik angewiesen sein bzw. man wird sie anders nutzen. Grammatik wird dann verstärkt über fremdsprachliche Erfahrungen in natürlichen Kommunikationssituationen erworben. Das Wissen, das man aus einer externen Grammatik entnehmen kann, dient in diesem Fall häufig dazu, die Aufmerksamkeit auf grammatische Erscheinungen zu lenken, die man aus natürlichen fremdsprachlichen Kommunikationssituationen kennt. Dadurch kann man sich die Möglichkeit verschaffen, den impliziten erfahrungsbasierten Erwerb grammatischer Phänomene der Zielsprache durch das gezielte und bewusste Erlernen der betreffenden Regularitäten auszubauen und zu stabilisieren.
Grammatisches Wissen macht Fremdsprachenlernen erfolgreich
Grammatisches Wissen unterstützt den Lernprozess, weil es Lerner für grammatische Erscheinungen der Fremdsprache sensibilisieren kann. Der aufmerksamkeitserregende Effekt von grammatischem Wissen fördert je nach Lernermerkmalen, v.a. Alter und Lernsituation, das Fremdsprachenlernen auf verschiedene Weise:
- Er kann gezielt Lernprozesse auslösen, indem der Lerner dazu gebracht wird, bewusst auf grammatische Erscheinungen im zielsprachlichen Input zu achten, die seinem jeweiligen lernersprachlichen Niveau entsprechen. Der Lerner wird dadurch in die Lage versetzt, sich die betreffenden Sprachbereiche durch bewusste Kognitivierung in Form von explizitem metasprachlichen Wissen über die grammatischen Regularitäten aneignen zu können.
- Auf diese Weise können die zum Lernen aufgewendete Zeit und die kognitiven Anstrengungen der Lerner in vernünftigen Grenzen gehalten werden.
- Schließlich kann grammatisches Wissen auch einen direkten Beitrag zum fremdsprachlichen Können leisten. Wegen der ihm zur Verfügung stehenden Zeit kann der Lerner bei Ausübung solcher Fertigkeiten wie Schreiben, vorbereitetes Sprechen oder Lesen auf seine expliziten grammatischen Wissensbestände zurückgreifen, um diese Aktivitäten zu planen und sich selbst dabei zu korrigieren.
Wegen ihrer aufmerksamkeitserregenden Funktion sind Grammatikkenntnisse somit alles andere als Umwege (oder gar Irrwege) beim Fremdsprachenlernen. Sie bieten Fremdsprachenlernern eine sinnvolle und entlastende Hilfestellung und leisten dadurch einen entscheidenden Beitrag zum erfolgreichen Fremdsprachenlernen.
Die kognitive Funktion von Grammatik
Verschiedene Darstellungsmöglichkeiten von außersprachlichen Situationen
durch grammatische Mittel
Eine Situation wie z.B. ‘Zu–Spät-Kommen’ können Sie in
vielen Sprachen mit Hilfe verschiedener grammatischer Konstruktionen darstellen,
aus der Perspektive des Grunds der Verspätung (Aktiv), oder der Person, die
sich verspätet hat, wobei sie den Grund der Verspätung nennen oder weglassen
können (Passiv mit oder ohne Angabe des Urhebers); vgl. im Dt. (1) (Es tut mir leid, dass ich so spät komme). Meine Nachbarin hat mich
aufgehalten. (Sie musste mir unbedingt ein Stück Geburtstagstorte mitgeben.) vs. (2) (...) Ich wurde von meiner Nachbarin aufgehalten.
(...) vs. (3) (...) Ich wurde aufgehalten. Je nach dem, was Sie sagen wollen, werden Sie eine dieser Möglichkeiten wählen, (1), wenn Sie den Sachverhalt neutral darstellen möchten, (2), wenn Sie sagen wollen, dass nicht Sie, sondern Ihre Nachbarin die Verspätung verursacht hat, (3), wenn Sie nichts darüber aussagen wollen (bzw. müssen), worin der Grund Ihrer Verspätung lag.
Literatur: Grammatiklernen macht Sinn
Die Sinnfrage der Beschäftigung mit Grammatik für das Fremdsprachenlehren und -lernen stellt und beantwortet:
- Gnutzmann, C. 2000 "Grammar – indispensable foundation or ideological construct?", in B. Helbig, K. Kleppin & F.G. Königs (Hrsg.) 2000 Sprachlehrforschung im Wandel. Beiträge zur Erforschung des Lehrens und Lernens von Fremdsprachen. Festschrift für Karl-Richard Bausch zum 60. Geburtstag, Tübingen: Stauffenberg, 193-204
Eine Unterscheidung von interner und externer Grammatik findet sich bei:
- Edmondson W.J. 1996 "Zur Rolle der Grammatik beim Fremdsprachenerwerb: der Einsatz der Sprachlehrforschung", in Aktuelle Probleme des universitären Fremdsprachenunterrichts. Universität Hamburg (= ZFI-Berichte, 11), 66-82
Darüber hinausgehende Differenzierungen zum Grammatikbegriff werden vorgeschlagen von:
- Börner, W./Vogel, K. 1976 "Zum Verhältnis von wissenschaftlicher und pädagogischer Grammatik in der Fremdsprachenlehre", in Börner, W. et al. (Hrsg.), Französisch lehren und lernen. Aspekte der Sprachlehrforschung. Frankfurt/M.: Scriptor, 7-39
- Helbig, G. 1992 "Wieviel Grammatik braucht der Mensch?", in Deutsch als Fremdsprache 29/3, 150-155
Lerner- (und Lehrer-) Einstellungen zur Grammatik untersucht:
- Zimmermann, G. 1984 Erkundungen zur Praxis des Grammatikunterrichts, Frankfurt am Main u.a.: Diesterweg
- Zimmermann, G. 1991 "Warum ist Grammatik trocken? Untersuchungen zu Lernerkognitionen im Fremdsprachenunterricht", in R. Grebing (Hrsg.) 1991 Grenzenloses Sprachlernen. Festschrift für Reinhold Freudenstein, Berlin: Diesterweg, 150-163
Einen Überblick, der den aktuellen Diskussionsstand zum wissensbasierten Fremdsprachenlernen und -lehren zusammenfasst, bietet:
- Grotjahn, R. 2000 "Sprachbezogene Kognitivierung: Lernhilfe oder Zeitverschwendung?",
in H. Düwell et al (eds.) 2000 Dimensionen der Didaktischen Grammatik. Festschrift für Günther Zimmermann zum 65. Geburtstag, Bochum: AKS, 83-106
Speziell unter der Fragestellung des Grammatiklernens wird die Rolle fremdsprachlichen Wissens im Spannungsfeld von "unmittelbare Lernhilfe" und "pure Zeitverschwendung" erörtert in:
- Edmondson, W. & House, J. 2000 (2. Aufl.) Einführung in die Sprachlehrforschung, Tübingen/Basel: Francke, 282-298
Ausführlich widmet sich dieser Problematik die Untersuchung:
- Tönshoff, W. 1992 Kognitivierende Verfahren im Fremdsprachenunterricht. Formen und Funktionen. Hamburg: Kovaã
Die "strong interface-position" vertritt:
- Anderson, J. 1995 Learning and memory. An Integrated approach, New York
Die "zero interface-position" ist mit S. Krashen vebunden, zuletzt dargelegt in:
- Krashen, S. 1994 "The input hypothesis and its rivals", in N.C. Ellis (ed.) 1994 Implicit and explicit Learning of Languages, London: Routledge, 45-77
Die zwischen beiden Auffassungen vermittelnde "weak interface-position" wird begründet in:
- Bialystok, E. 1994 "Representation and ways of knowing: Three issues in second language acquisition", in N.C. Ellis (ed.) 1994, Implicit
and explicit Learning of Languages, London, 549-569
Edmondson, W. J. 1999 Twelve Lectures on Second Language Acquisition. Foreign Language Teaching and Learning Perspectives. Tübingen: Narr, 245-257
Einen Überblick über die verschiedenen Auffassungen, die in der Sprachlehrforschung mit language awareness verbunden werden, geben:
- Edmondson, W. & House, J. 1997 "Language Awareness. Einführung in den Themenschwerpunkt", in Fremdsprachen lehren und lernen 26, 2-8
