Lesen in der Fremdsprache
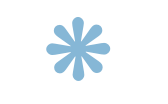
Lesen in der Fremdsprache
Wenn Sie eine Fremdsprache lernen, haben Sie im Regelfall das Lesen als Sprachtätigkeit schon an der Muttersprache gelernt. Damit verfügen Sie über ein mehr oder weniger entwickeltes Inventar von Lesestilen, die Ihnen zu möglichst flüssigen und erfolgreichen Leseprozessen verhelfen.
Diese Lesefähigkeit können Sie im Prinzip auf das Lesen in der Fremdsprache übertragen. Allerdings ist dies nicht immer vollständig möglich. Dafür sind drei Gründe veranwortlich, die miteinander verknüpft sind:
- Es gibt Unterschiede von Mutter- und Fremdsprache, die verschiedene Leseverfahren erfordern.
- Ihre Kompetenz in der Fremdsprache ist unzureichend.
- Sie können Ihre Lesestrategien nicht anwenden, weil die Leseaufgabe zu komplex ist.
Totales Lesen:
Bei diesem Lesestil sollten Sie sich folgende Fragen stellen:
- Vorab: Lohnt es sich, den Text, den Sie vor sich haben, ganz oder teilweise mit dem Ziel des vollständigen Verstehens zu lesen? Was haben Sie davon?
- Während des Lesens: Lohnt es sich, den jeweils nächsten Satz oder Paragraphen gründlich zu lesen oder können Sie auf kursorisches oder gar selektives Lesen umschalten? Warum?
- Reichen Ihre Sprachkenntnisse aus, um den Text vollständig zu verstehen? Brauchen Sie Hilfsmittel (Wörterbuch, ggf. Grammatik)?
- Kennen Sie die jeweils verwendeten Wörter und Ausdrücke? Können Sie unbekannte Ausdrücke plausibel aus dem Kontext erschließen? Wollen Sie lieber im Wörterbuch nachschlagen?
- Erscheinen Ihnen die einzelnen Aussagen des Textes klar und schlüssig? Sind die logischen Bezüge sprachlich klar markiert? Ist die Schilderung anschaulich? Oder will der Autor vielleicht unklar bleiben?
- Passt der Inhalt zu dem, was Sie an Information suchen? Bestätigt er Ihr Wissen? Lernen Sie etwas Neues aus dem Text?
- Stimmen Sie den Aussagen des Textes zu? Sind Sie anderer Meinung?
Schreiben Sie Ihre Einzelkommentare auf und fassen Sie sie am Ende zu einem kritischen Gesamtkommentar zusammen.
Unzureichende Sprachkompetenz
Sprachkompetenz - auch in der Fremdsprache - umfasst sowohl Wissen wie Können. Mangelnde Sprachkompetenz in der Fremdsprache kann Ihre im Prinzip vorhandene Lesefähigkeit beeinträchtigen.
- Mangel an Sprachwissen kann auf auf allen Ebenen des Leseprozesses auftreten.
Es kann sein, dass Sie bestimmte Schriftzeichen, Wörter, Grammatikformen
oder syntaktische Regeln einfach noch nicht gelernt haben. Dann verstehen
Sie möglicherweise nicht, was Sie da lesen und müssen raten.
- Mangel an Sprachkönnen kann bedeuten: Zwar haben Sie Schriftzeichen,
Wörter oder Morpheme gelernt, aber Sie können darauf beim Lesen
noch nicht routiniert zugreifen - Sie brauchen Zeit, müssen überlegen
und manches fällt Ihnen nicht ein. Dann lesen Sie langsam und unsicher
und verstehen manches vielleicht nur ungenau.
Im fremdsprachlichen Lesen kommt es häufig vor, dass Wissenslücken
auf einer Ebene, z.B. lexikalische Lücken, Folgen für Prozesse anderer
Ebenen haben, auch wenn dort im Prinzip gar keine Defizite vorliegen. Das sind
dann Folgen einer Überlastung des Arbeitsgedächtnisses.
Unzureiches Sprachwissen kann beim Lesen durch intelligentes Raten zum Teil aufgefangen werden. Das Erraten von Bedeutung kennen Sie im Prinzip schon aus der Muttersprache, wenn Sie einem unklaren Text versuchsweise eine bestimmte Bedeutung unterstellen. Beim fremdsprachlichen Lesen ist das Raten von Bedeutung kaum vermeidbar, weil Sie in jedem Text, wenn er nicht didaktisch gereinigt ist, auf unbekannte Wörter und Wendungen stoßen können. Mehr zu Strategien des Vokabelratens.
Beispiele für Antizipation
In den folgenden Beispielen bricht der Text mitten in einem Wort, in einer Wendung oder in der Entwicklung eines Gedanken ab. Sie sollen erraten, wie es weitergeht oder weitergehen könnte. Überlegen Sie, was Ihnen dabei im Einzelnen helfen kann (Sprachwissen? Textwissen? Weltwissen? Eigene Phantasie?). Ich hoffe, Sie verstehen, was ich ---
Wie geht es weiter?
-
dt. er wohnt in der Bundesre ---; frz. parfois la vie est
insup ---; engl. suddenly the girl started to scr ---
-
dt. Dies ist richtig. Man muss jedoch ---; frz. Veuillez agréer,
---; engl. last but ---
-
dt. Er war völlig überarbeitet. Deshalb wollte er am folgenden
Sonntag ---;
frz. Si vous voulez bien manger à Paris, essayez de ---;
engl. You are so sweet, he whispered. The more I see you, the more ---
-
dt. Ich habe Angst, in die USA zu fliegen, weil ---;
frz. La France est un pays aux multiples paysages. Ceux-ci comprennent aussi bien ---;
engl. The main reason for the reduction in the death rate in the developing world has been improved public health measures. For example, ---
- Es war einmal ein König, der hatte drei Söhne. Der erste --- Der zweite --- Schließlich musste der dritte ---
Unterschiede von Mutter- und Fremdsprache
Sprachliche Unterschiede, die sich auf das Lesen auswirken, können die Schrift, das Sprachsystem und zuweilen auch kontrastierende Textsorten betreffen.
Schrift:
- Viele Sprachen haben auch bei gemeinsamer, z.B. lateinischer Schrift andere Sonderzeichen und Buchstaben-Kombinationen (z.B. frz. à, ê, span. ñ oder ital. cc, cch, engl. gh usw.).
- Häufig sind bei gleichen Zeichen die Buchstaben-Laut-Zuordnungen anders (z.B. dt. Mine, engl. mine oder dt. Mond, frz. monde). Das kann die Worterkennung verlangsamen.
- Wenn die Fremdsprache ein ganz anderes Schriftsystem benutzt, so etwa im Russischen, Arabischen oder Chinesischen, müssen neue Zeichen gelernt und beim Lesen dekodiert werden.
Sprachsystem:
- Sprachen bilden nur selten die gleichen Konzepte. Ein Beispiel: der deutschen Straße entsprechen im Frz. zwei Wörter, nämlich rue (in einer Stadt) und route (außerhalb der Stadt). Ein französischer Deutschlerner muss, wenn er Straße liest, zum genauen Verständnis den Kontext zu Rate ziehen.
- Sprachen haben verschiedene Grammatik: Ein englischer oder französischer Deutschlerner muss wegen der Verb-End-Stellung im Deutschen neu lernen, beim Lesen von Nebensätzen bis zum Ende zu ... warten, wenn er verstehen ... will, worum es ... geht.
Texte:
- Konventionelle Textsorten, z.B. Geschäftsbriefe oder Familienanzeigen, werden in verschiedenen Sprachen ganz verschieden gestaltet. Wer sie liest, muss wissen, was die Konventionen im einzelnen bedeuten. Auch rhetorische Muster wie Textaufbau oder Erzählperspektive können kulturgeprägt sein und damit andere Lesegewohnheiten erfordern.
Forschungsliteratur zum Gegensatz "Lesen in der Muttersprache/Fremdsprache"
Auf die Frage, was beim Lesen in der Fremdsprache anders ist als in der Muttersprache,
gehen alle im Literaturverweis auf Leseprozesse
aufgeführten Arbeiten mehr oder weniger gründlich ein.
Zwei spezielle Arbeiten (unter vielen) zu der Frage, welchen jeweiligen Anteil an fremdsprachlichen Lesedefiziten die Fremdsprach- oder die Lesekompetenz haben:
- Carrell, P. 1991 Second Language Reading: Reading Ability or Language Proficiency. In: Applied Linguistics 12, 159-172.
- Davis, J. N.; Bistodeau, L. 1993 How do L1 and L2 Reading Differ? Evidence from Think Aloud Protocols. In : The Modern Language Journal 77, 459-472.
