Erfolgreich kommunizieren
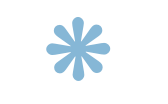
Durch eine gute Aussprache erfolgreich in der Fremdsprache kommunizieren
Wenn Sie über eine gute Aussprache verfügen, können Sie sicher sein, dass Ihr Gesprächspartner Sie als Fremdsprachenlerner ernstnimmt. Ein angenehmer Nebeneffekt liegt darin, dass gute phonetische Fertigkeiten in der Wahrnehmung Ihrer Gesprächspartner Defizite, die Sie (noch) woanders haben, zum Teil überspielen können. Die Aufmerksamkeit, vielleicht sogar Bewunderung Ihrer Kommunikationspartner ist dann verstärkt auf Ihre Aussprache gerichtet. Fehler, die Sie z.B. bei der Grammatik machen, fallen dann nicht unbedingt auf, weil sie einfach überhört werden.
Wenn Ihre Aussprachefehler sich hingegen häufen und ständig wiederkehren, müssen Sie mit negativen Reaktionen seitens Ihrer Gesprächspartner rechnen, z.B. mit Irritationen, Ermüdung beim Zuhören, sozialer Geringschätzung Ihrer Person bis hin zum Abbruch der Kommunikation. Dieses Verhalten Ihrer Gesprächspartner kann auch auf Sie als Fremdsprachenlerner zurückwirken. Missglückte Kommunikationsversuche lösen Enttäuschung über den eigenen Lernerfolg aus. Folge dieser Erfahrung kann sein, dass Sie, wo immer möglich, es vermeiden, die Fremdsprache mündlich zu gebrauchen und Ihre Bemühungen, die Aussprache zu erlernen, ganz einstellen.
Sie sind daher immer gut beraten, sich konsequent um eine korrekte Aussprache zu bemühen. Allerdings ist leider auch richtig, dass eine Aussprache der Fremdsprache, die der von Muttersprachlern gleichkommt, zumeist ein unrealistisches Lernziel ist. Trotzdem: Versuchen Sie es!
Allgemeine Ursachen für den Misserfolg fremdsprachlicher Kommunikation
Die Fälle, in denen eine falsche Aussprache zum Misslingen mündlicher Kommunikation führen kann, lassen sich idealtypisch in zwei Klassen unterteilen. Dies hängt davon ab, ob die missglückte Kommunikation vom Fremdsprachenlerner/ -sprecher oder vom muttersprachlichen Hörer aus betrachtet wird:
- Fehlartikulationen können einerseits gegen die von der Sprachgemeinschaft akzeptierte Aussprachenorm verstoßen.
- Fehlartikulationen können zu Verständnisproblemen führen, wenn der Hörende Wörter nicht erkennen kann oder sie mit anderen verwechselt.
Die lautliche Seite der Sprache wird in ihren Funktionen für die mündliche Kommunikation in der linguistischen Disziplin Phonematik beschrieben.
Häufige Ursachen für das mangelhafte Lernen von Aussprache
Für den Misserfolg sprachlichen Handelns durch eine mangelhafte Aussprache, wie er v.a. bei älteren Lernern zu beobachten ist, sind zumeist motivationale, psychosoziale und kognitive Faktoren ausschlaggebend.
Vor allem ältere Lerner sind häufig nicht bereit, ungewohnte, schwierige Lautungen zu erlernen. Ihr Unbehagen oder gar ihre Abwehr, Laute zu produzieren, die von der vertrauten muttersprachlichen Artikulation abweichen, ergibt sich aus ihrer stark an die Muttersprache gebundenen psychosozialen Identität. Eine korrekte Aussprache der Fremdsprache bedeutet daher für diese Personengruppe häufig eine unnatürliche, ungewollte, nur gegen ihren affektiven Widerstand zu erzielende psychosoziale Distanzierung von der Muttersprache und deren Kultur. Das bewusste Festhalten an einer "akzentbehafteten" Aussprache kann daher für diese Lerner ein psychosozialer Selbstschutzmechanismus sein, um sich nicht mit der Fremdsprache und deren Kultur identifizieren zu müssen.
Häufige Ursachen für das mangelhafte Verstehen von Aussprache
Negative Reaktionen, die muttersprachliche Hörer häufig auf eine dauerhaft falsche Aussprache zeigen, können kognitiv und/oder affektiv bedingt sein. Sinkende Aufmerksamkeit und Ermüdung von Hörern lassen sich aus einer Überforderung der kognitiven Ressourcen bei der lautlichen Dekodierung fremdsprachlicher Äußerungen erklären. Wenn der Hörer innerlich immer wieder Fehllautungen korrigieren muss, bleibt ihm weniger an kognitivem Potential für die inhaltliche Wahrnehmung (sog. semantisches Verstehen) der Äußerung. Dies kann dazu führen, dass er seine Suche nach Sinnkonstanz, d.h. nach einem plausiblen, nachvollziehbaren Inhalt im Gehörten einstellt und nicht mehr verstehen kann (oder will). Der Hörer kann auch Abneigung oder Ablehnung gegenüber seinem Gesprächspartner empfinden, da dieser durch seine fehlerhafte Aussprache die "Spielregeln" der sprachlichen Kommunikation verletzt und sich dem Hörer gegenüber unkooperativ verhält.
Umgekehrt gilt, dass positive hörerseitige Reaktionen auf eine gute Aussprache auf einer Eigenschaft der menschlichen Wahrnehmung beruhen, die in der Sozialpsychologie als Hof-Effekt (engl. halo-effect) bezeichnet wird. Die menschliche Wahrnehmung und Wertung von Erscheinungen erfolgt nie isoliert, sondern immer in Abhängigkeit von einer Vielzahl anderer Eigenschaften. Somit kann eine gute Aussprache z.B. Schwächen in Grammatik ausgleichen, genauso wie eine liebenswürdige, gutaussehende Person durch eben diese nichtsprachlichen Qualitäten ihre fehlerbehaftete Aussprache – beides allerdings nur in gewissen Grenzen.
Aussprache
Im Zusammenhang mit Fremdsprachenlernen ist das Wort "Aussprache" mehrdeutig. In der Feststellung "Er hat eine schlechte Aussprache" meint es einen für die Zielsprache fremden "Akzent", d.h. eine nichtnormgerechte Art des Aussprechens dieser Sprache.
Im folgenden bezieht sich, sofern nicht weiter erläutert, das Wort Aussprache (auch: Lautung, Lautgestalt) dagegen auf etwas anderes: die Fertigkeit, eine Fremdsprache korrekt auszusprechen (zu artikulieren). Diese Fertigkeit umfasst somit alle lautlichen Eigenschaften, die Sprachen haben können, z.B. Einzellaute, Lautverbindungen, Tonhöhen, Wort- und Satzakzent, Satzintonation, Melodie, Rhythmus u.Ä.
Phonematik
Die Phonematik untersucht, wie Sprachlaute gebildet und wahrgenommen werden, d.h. sie beschreibt die lautlichen Grundlagen des Sprechens und Hörverstehens. Die sog. segmentale Phonematik beschreibt Einzellaute und deren Kombinationen, die sog. suprasegmentale Phonetik höherstufige Erscheinungen, z.B. den Wortakzent und die Intonation. Die Phonematik untergliedert sich in Phonetik und Phonologie.
Literatur
Die Phonetik ist naturwissenschaftlich orientiert, bemüht sich um eine exakte Messung und beschreibt die physikalische oder physiologische Substanz der Laute einer gegebenen Sprache. Ihre Einheit ist das Phon (in [ ] notiert). Sie zerfällt in drei "Einzelphonetiken":
- die artikulatorische Phonetik; sie ist sprecherorientiert und zielt auf die Prozesse der Lautbildung ab
- die akustische Phonetik; sie ist mediumorientiert und auf die die Sprachlaute erzeugenden Schallwellen gerichtet;
- die auditive Phonetik; sie ist hörerorientiert und zielt auf die durch die Schallwellen ausgelösten Verstehensprozesse ab.
Phonologie ist dagegen interpretierend. Sie berücksichtigt die phonetische Beschaffenheit der Sprachlaute nur insoweit, wie diese in der Lage sind, Bedeutungen zu unterscheiden. Ihre Einheiten, die Phoneme (in // notiert), sind daher geringer an Zahl, abstrahieren im Vergleich zur Phonetik von den tatsächlichen Lautgestalten stärker und werden in Abhängigkeit von den einzelsprachlichen funktionalen Gegebenheiten festgelegt. Beispiele.
Wortakzent
Unter Wortakzent versteht die Phonematik die Silbe im Wort, die als besonders hervorgehoben wahrgenommen wird. Sie ist, je nach betrachteter Sprache in unterschiedlicher Kombination, durch Eigenschaften wie längere Dauer im Verhältnis zu den anderen Silben (Quantität), verstärkte Ausatmung (expiratorischer Druck), höhere Grundfrequenz der klangerzeugenden Schwingungen und vergrößerte Muskelspannung (Intensität) charakterisiert.
Bei akzentuierten Silben mit höherer Grundfrequenz spricht man vom melodischen Akzent (z.B im Schwed., Kroat.), höhere Intensität erzeugt den dynamischen Akzent, z.B. Dt. (den Wohnwagen in einer Scheune) unterstellen vs. (jdm. etw.) unterstellen.
Intonation
Unter Intonation versteht die Phonematik Bündel von stimmlichen Verlaufseigenschaften (Stimmtonverlauf, Klang/Timbre u.ä.) mit kommunikativer und/oder emotionaler, subjektiv-wertender Funktion. Durch intonatorische Mittel können sich z.B. verschiedene kommunikative Satztypen wie Aussage-, Frage-, Ausrufesatz gestaltet und/oder Äusserungen emotional gefärbt werden, z.B. als Ausdruck von Ironie, Verwunderung, Drohung.
Beispiele für phonematische Erscheinungen
a) Verstöße gegen nichtbedeutungsunterscheidende Aussprachenormen (der Apostroph ' weist bei russ .Beispielen auf die palatalisierte, d.h. mit j-Element artikulierte Aussprache des vorangehenden Konsonanten hin, betonte Silben sind unterstrichen):
dt. Kü[X]e mit ach-Laut anstelle von korrekt Kü[ç]e mit ich-Laut
russ. [vor] 'Dieb' mit Zäpfchen- oder Reibe-R wie im Deutschen anstelle des korrekten Zungenspitzen-R (auch gerolltes R genannt)
finn. ystävä anstelle von korrekt ystäva ('Freund')
poln. torebka anstelle von korrekt torebka ('Handtasche')
russ. karandaš anstelle von korrekt karandaš ('Bleistift')
Alle mehrsilbigen Wörter werden im Finn. auf der ersten, (fast) alle im Poln. auf der vorletzten Silbe betont, im Russ. kann jede Silbe betont werden.
b) Verstöße gegen bedeutungsunterscheidende Aussprachenormen:
Bei Lauten:
dt. Haust/i:/rgeschäfte anstelle von Haust/y:/rgeschäfte
russ. /r/ad ('froh') anstelle von /r'/ad ('Reihe')
Bei Akzenten:
dt. (ein Hindernis) umfahren anstelle von umfahren
russ. pisat' ('pissen') anstelle von pisat' ('schreiben')
c) Intonation:
dt. Sie haben russische *Bücher?
russ. U vas *est' russkie knigi?
Der steigende Satzakzent, markiert durch * vor dem Wort, liegt auf unterschiedlichen Segmenten der dt. (Bücher) bzw. russ. (est') Trägerstruktur.
d) Einzelsprachspezifische Funktionen von Lauten:
Während im Dt. die Opposition "palatalisiert : nichtpalatalisiert" keine phonologische ist, kennzeichnet sie das russ. Konsonantenphonemsystem fast durchgängig, z.B. russ. bra/t/ ('Bruder') : bra/t'/ ('nehmen').
Das finn. Konsonantenphonemsystem ist durch die Opposition +/- Glottalverschluss (= Unterbrechung des Stimmtons durch Verschluss der Stimmritze) gekennzeichnet, z.B. ku/k/a ('wer?') : ku/kk/a ('Blume'). Der phonetisch ähnlich Neuansatz oder Knacklaut (= Einsetzen der Stimmlippen) bei dt. Vokalen am Wort- oder Silbenanfang, z.B.[ɜ]r[æ]rbeiten, ist für das Dt. keine phonologische Erscheinung.
Literatur: Phonematik
Einführungen in die Phonematik, die ohne Spezialkenntnisse gut lesbar ist, finden sich bei:
- Ashby, P. (1995): Speech Sounds. London/New York: Routledge.
- Linke, A. & Nussbaumer, M. & Portmann, P.R. (31996): Studienbuch Linguistik. Tübingen: Niemeyer, 401-436. (= Reihe Germanistische Linguistik Bd. 121 Kollegbuch)
Ausführliche wissenschaftliche Darstellungen der Disziplin geben:
- Clark, J. & Yallop, C (21995): An Introduction to Phonetics and Phonology. Oxford: Blackwell.
- Hardcastle, W.J. & Laver, J. (eds.) (1997): The Handbook of Phonetic Science. Oxford: Blackwell.
Ein terminologisches Nachschlagewerk zur Phonetik/Phonologie ist:
- Trask, R.L. (1996): A Dictionary of Phonetics and Phonology. London/New York: Routledge.
Einen Überblick über die phonematischen Eigenschaften verschiedenster Sprachen geben:
- Ladefoged, P. & Maddieson, J. (1996): The Sounds of the World’s Languages. Oxford: Blackwell.
- Hirschfeld, U. u.a. (Hrsg.) (1999): Phonetik international. Grundwissen von Albanisch bis Zulu. Grimma: Heidrun Popp Verlag.
