Übungen und Strategien
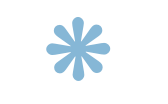
Arbeitsweise mit Übungen und Strategien
Werden Sie sich klar darüber, wie Sie Übungen bearbeiten, und setzen Sie Strategien ein
Erhöhen Sie ihr eigenes Bewusstsein über das Lösen von Aufgaben. Vergrößern Sie Ihr metakognitives Wissen, also ihr Wissen über Sprachverwendung und Sprachenlernen. Das Erhöhen des eigenen Bewusstseins kann das Wahrnehmen von Strukturen steigern, was sich behaltens- und erwerbsfördernd auswirken kann.
Versuchen Sie zu ermitteln, welche Strategien Sie bei der Aufgabenbearbeitung einsetzen. Versuchen Sie dazu, laut zu denken, während Sie eine Übung bearbeiten. Nehmen Sie dies auf Kassette auf und versuchen Sie (vielleicht mit einem Partner), bestimmte Strategien zu identifizieren.
Setzen Sie zusätzliche Aufgabenbearbeitungs-Strategien ein. Dabei scheinen drei Basisoperationen für das erfolgreiche Lösen von Aufgaben relevant zu sein.
- Analysieren Sie die Arbeitsanweisung und etwaige Musterbeispiele.
- Analysieren Sie den Kontext der (Teil-)Aufgabe. Suchen Sie nach formalen und inhaltlichen Schlüsselinformationen sowohl auf einer speziellen Ebene (Grammatik, Semantik) als auch auf einer übergreifenden Ebene (Pragmatik, Textstruktur).
- Aktivieren Sie ihr fremdsprachliches Wissen. Greifen Sie dabei auf explizites Wissen (z.B. Regeln) oder implizites Wissen ("Sprachgefühl") zurück.
Je nachdem, ob Sie das Lösungsergebnis oder das Lernergebnis verbessern wollen, sollten Sie neben den Basisoperationen bestimmte (zusätzliche) Strategien einsetzen.
Lautes Denken und Strategienkatalog
Das Verfahren des Lauten Denkens wird traditionell zur Untersuchung mentaler Prozesse eingesetzt. Dabei wird angenommen, dass die Äußerungen mehr oder weniger direkt kognitive Operationen wie z.B. die Aktivierung von Wissensformen oder den Einsatz von Strategien widerspiegeln. Versuchen Sie dazu, alle Gedanken, die Ihnen bei der Bearbeitung durch den Kopf schießen, auszusprechen. Kommentieren oder analysieren Sie Ihr Handeln nicht, sondern sprechen Sie einfach. Im Anschluss daran können Sie die Kassettenaufnahmen analysieren und Strategien identifizieren.
Bei einer Untersuchung zu grammatischen Lernaufgaben mit italienischen Deutschlernern stellte sich der folgende (offene) Strategienkatalog zur Aufgabenbearbeitung heraus.
Analyse der/des
- Überschrift
- Zeichnungen
- Vokabelerklärungen
- sprachlichen Materials
- Arbeitsanweisung (AA)
- Auswahl-Elemente (AE)
- Musterbeispiels
Sprachliche Strategien: Sprachrezeption
- Übersetzen in die Muttersprache
- Lesen:
a) normal,
b) wiederholend,
c) Im-Voraus-Lesen,
d) scanning (d.h. die Aufgabe nach einen bestimmten Wort absuchen) - lautes Aus- / Vorsprechen
- sich die Situation vorstellen
- grammatische Analyse vornehmen
Sprachliche Strategien: Sprachproduktion
- Übersetzen in die Muttersprache
- Übersetzen in die Zielsprache
- Mutter- und Zielsprache vergleichen
- Zielsprache und eine weitere Fremdsprache (z.B. Englisch) vergleichen
- eine weitere Fremdsprache (z.B. Englisch) aufrufen
- lautes Aus- / Vorsprechen
- Auswahl-Elemente testen
- Kontrolllesen
- Buchstabieren
- grammatische Analyse vornehmen
- eine Regel aufrufen
- ein Paradigma (z.B. ich wollte, du wolltest, er wollte, wir wollten ...) aufrufen
- ein chunk (als Einheit gespeichertes, meist unanalysiertes sprachliches Versatzstück)
aufrufen
Zuteilung von Zeit und Aufmerksamkeit
- Überspringen von Teilaufgaben
- Rekurrieren auf Teilaufgaben
- vorläufiges Lösen von Teilaufgaben
- Vergleichen von Teilaufgaben
- Überprüfen von Teilaufgaben
Formale Strategien
- Kopieren (vom Musterbeispiel)
- Lösungen abwechseln / gleiche Lösung vermeiden
- Lösungskonsequenz / gleiche Lösung verwenden
- Auswahl-Elemente ausstreichen
- Lösung / Auswahl-Elemente (sukzessive) abwählen / ausschließen
- Markieren
- Parallelen aufdecken
zusätzliche Strategien
- Hypothesen oder Schlussfolgerungen für die folgende Bearbeitung formulieren
- Einordnen des Grammatikbereichs / Zuordnen zu bestimmten Unterricht
- noticing the gap (Wahrnehmen und Schließen von Wissenslücken)
- Wissen extrahieren
- Hilfsmittel konsultieren (Grammatik, Wörterbuch)
- Raten
Die Strategien sind nach sechs Bereichen geordnet. Der erste Bereich umfasst die Analyse der Vorgaben, also des gesamten sprachlichen und außersprachlichen Materials, das die Aufgabe zur Verfügung stellt. In der Regel wirkt sich eine gründliche Analyse der gesamten Vorgaben positiv sowohl auf das Lern- als auch auf das Lösungsergebnis aus. Der zweite und dritte Bereich umfasst die sprachlichen Strategien zur Sprachproduktion bzw. Sprachrezeption. Hier wird z.T. von den gleichen Strategien Gebrauch gemacht und vorrangig sprachliches Wissen eingesetzt. Der Bereich der Zuteilung von Zeit und Aufmerksamkeit und die formalen Strategien greifen dagegen überwiegend auf strategisches Wissen zurück, das oft eingesetzt wird, wenn das sprachliche Wissen nicht ausreicht. Der Bereich der zusätzlichen Strategien - außer der Strategie des Ratens - scheint für die Verbesserung des Lernergebnisses besonders hilfreich.
Literatur zu Introspektion und Lautem Denken
Eine Einführung in den Bereich der Introspektion liefern
- Huber, G. L./Mandl, H. (1982): "Verbalisierungsmethoden zur Erfassung von Kognitionen im Handlungszusammenhang". In: Huber, G. L./Mandl, H. (eds.): Verbale Daten. Eine Einführung in die Grundlagen und Methoden der Erhebung und Auswertung. Weinheim, Basel: Beltz. 11-42.
- Faerch, C./Kasper, G. (eds.): Introspection in Second Language Research. Clevedon: Multilingual Matters.
Das Laute Denken wird dargestellt von
- Weidle, R./Wagner, A. C. (1982): "Die Methode des Lauten Denkens". In: Huber, G. L./Mandl, H. (eds.): Verbale Daten. Eine Einführung in die Grundlagen und Methoden der Erhebung und Auswertung. Weinheim, Basel: Beltz. 81-103.
Zusätzliche Strategien
Beim Üben sollte das Ziel die Steigerung des Lernergebnisses sein. Dazu können Sie die folgenden Strategien einsetzen:
- Sofern es außersprachliches Material (Zeichnungen, Bilder, Diagramme, Tabellen) gibt, analysieren Sie es und setzen Sie es mit dem sprachlichen Material in Verbindung. Versuchen Sie, das sprachliche Handeln in den gegebenen Situationen und Kontexten nachzuvollziehen und zu üben. Lassen Sie ihrer Fantasie freien Lauf.
- Aktivieren Sie Wissen auch aus anderen Sprachen (Muttersprache, weitere Fremdsprache).
- Aktivieren Sie Ihr Weltwissen, indem Sie sich z.B. Situationen und reales sprachliches Handeln vorstellen.
Als besonders lernfördernd können die folgenden Strategien angesehen werden:
- Hypothesen oder Schlussfolgerungen für die folgende Bearbeitung formulieren.
Versuchen Sie, wenn Ihnen eine besondere Sprachform oder die Verwendung einer bestimmten Struktur auffällt, eine Hypothese zu formulieren, wie diese Form gebildet oder in welchen vergleichbaren Situationen diese Struktur gebraucht wird. Versuchen Sie, diese Hypothesen im Rahmen der Aufgabenbearbeitung oder bei der Besprechung zu verifizieren. Dazu können Sie Wörterbücher, Lehrbücher, Grammatiken benutzen oder Lehrpersonen, Muttersprachler, Lerner höheren Niveaus fragen. - Wissen extrahieren.
Extrahieren Sie Wissen, indem Sie verifizierte Hypothesen z.B. in einer Kladde oder im Computer festhalten und auswendig lernen. - noticing the gap (= Wahrnehmen und Schließen von Wissenslücken).
Beim noticing the gap sollten Sie mögliche Wissenslücken bemerken und versuchen, durch Schlussfolgerungen aus anderen Wissensbereichen oder durch Zuhilfenahme von externen Wissensquellen diese Wissenslücken zu schließen. Versuchen Sie also, Probleme oder Defizite in ihren Wissensbeständen zu erkennen und zu beheben. - Hilfsmittel (Grammatik, Wörterbuch, Experten) konsultieren.
Beispiel
Wenn Sie dagegen eine möglichst geringe Zahl an Fehlern in der Aufgabe anstreben, wenn Sie also das Lösungsergebnis (z.B. in einem Test) verbessern wollen, aber möglicherweise Probleme beim Aufruf des fremdsprachlichen Wissens haben, können Sie verstärkt formale Strategien einsetzen. Zu den formalen Strategien, die unter bestimmten Bedingungen erfolgversprechend sein können, gehört z.B. das Kopieren von Elementen oder das Raten bei der Lösungsformulierung. Häufig werden formale Strategien auch mit strategischen Überlegungen verknüpft, z.B. beim Ausstreichen von Auswahl-Elementen, um die restlichen Lösungen zu reduzieren, beim (sukzessiven) Abwählen von Lösungen oder Auswahl-Elementen oder beim Abwechseln von Lösungen, um eine typische Lösungsverteilung zu imitieren. Ebenso können Parallelen in der Aufgabe gesucht und Lösungen verglichen werden.
Der Erfolg dieser Strategien hängt von einer Reihe von Faktoren (unterstützendes fremdsprachliches Wissen, Aufgabenstruktur usw.) ab und führt nicht selten zu falschen Lösungen. Die Strategien sind also mit einer gesunden Skepsis zu betrachten und besser nur dann einzusetzen, wenn man über andere Strategien zu keiner Lösung gelangt.
Der Einsatz möglichst vieler Strategien muss nicht unbedingt ein gutes Lösungsergebnis nach sich ziehen. Ausreichendes sprachliches Wissen und ein optimiertes Strategien-Set führen häufig zu guten Lösungsergebnissen. Gestehen Sie sich also ein, ob der geringe bzw. optimierte Strategie-Einsatz durch die flache Bearbeitung (keine Zeit, keine Lust ...) oder durch ausreichendes sprachliches Wissen ausgelöst wird.
Beispiel: Strategien, die das Lernergebnis steigern: noticing the gap
Bei dem folgenden Transkript-Auszug (Motz 1999, Unveröff. Magisterarbeit, Universität Hamburg/ Sprachlehrforschung) handelt es sich um ein auf Kassette aufgenommenes und verschriftlichtes Laut-Denk-Protokoll eines italienischen Deutschlerners. Dieser Lerner, nennen wir ihn Enzo, musste eine grammatische Lernaufgabe, eine Art Lückentext mit Bildern, zu den deutschen Modalverben im Präteritum bearbeiten und dabei laut denken. Zur Erläuterung der verschiedenen Symbole und Schriftarten schauen Sie bitte weiter unten bei den Transkriptkonventionen.
Also [4s] Also [stöhnt] [2s] gehen zur Schule gehen e=hm dovevo anda\ MUSSTE Also musste ich [1s] [schreibt] müss=te ich weiter zur Schule gehen. sì perché questo è un'imposizione [3s] no musste durfte [schreibt] mi&ero&un&po'&confuso must must konn\ konn\ e durft\ allora questo è \[1s] eh questo durfte lo uso sempre male ci devo ritornare sopra durfte quindi devo riguardare mhm anche prima Und dauernd [1s] eh anche prima durfte DOVETTI [schreibt] [1s] durfte ich mein Zimmer aufräumen. devo tornare sempre su durfte [schreibt] durf=te [1s] okay durfte [4s] durfte poi vediamo bene eh und dann Techniker in einem
Im Interview und im Protokoll wird deutlich, dass Enzo Schwierigkeiten mit der semantischen Abgrenzung der Modalverben "können" und "dürfen" hat. An der Äußerung "questo durfte lo uso sempre male ci devo ritornare sopra" (dtsch. "dieses durfte benutze ich immer falsch, das muss ich mir noch mal anschauen") wird deutlich, dass Enzo eine Lücke bzw. Unsicherheit in seinem Wissen erkennt und nach Beendigung der Aufgabe diese Wissenslücke schließen will. In einem zusätzlichen Interview erläutert er, dass er dazu eine Grammatik benutzen würde. Enzo wendet also die Strategie des noticing the gap an, die das Ziel verfolgt, nicht nur die Items zu lösen, sondern wirklich etwas durch die Aufgabenbearbeitung und die anschließende Revision zu lernen.
Transkriptkonventionen
| Verschleifung | & |
| Abbruch | \ |
| Dehnung | = |
| Betonung | fett |
| lernersprachliche Äußerungen | kursiv |
| eindeutiges lautes Lesen einer Textvorlage | kursiv + unterstrichen |
| eindeutiges lautes Lesen einer Textvorlage in L1 | normal + unterstrichen |
| eindeutiges Übersetzen in L1 | KAPITÄLCHEN |
| eindeutiges Übersetzen ins Deutsche | KURSIV + KAPITÄLCHEN |
| Pause von X Sekunden | [Xs] |
Literatur zu notice the gap
Das Phänomen notice the gap wurde einleitend dargestellt von
- Schmidt, R./Frota, S. (1986): "Developing basic conversational ability in a second language: A case study of an adult learner of Portuguese." In: Day, R. (ed.): Talking to Learn: Conversation in a Second Language. Rowley, MA: Newbury House. 237-326.
Aufgegriffen und in das Lernmodell "Restructuring" integriert wurde notice the gap von
- McLaughlin, B. (1990): "Restructuring". In: Applied Linguistics 11. 113-128.
